



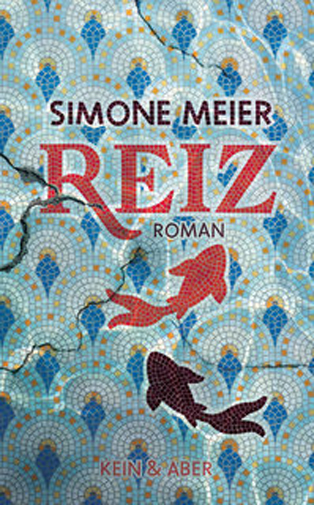

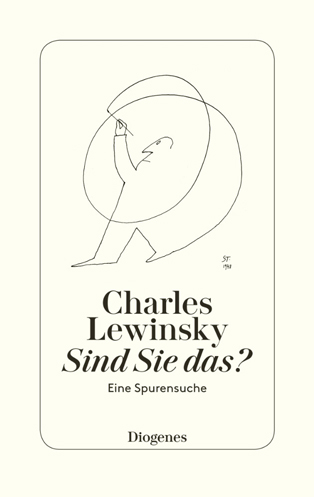

«Christian Kracht: Eurotrash – eine irrwitzige Reise durchs Mutterland»
Von Ingrid Schindler.
Christian Krachts Roman «Eurotrash» ist die Fortsetzung seines viel gelobten Debütromans «Faserland» von 1995. Die irrwitzige, selbstironische Reise führt durch die Schweiz, mit dem für Kracht typischen Spiel mit biografischen Details.
Der Sohn besucht regelmässig seine Mutter an der Goldküste. Ob es wirklich die Goldküste ist, weiss er nicht, ist ihm auch egal, es könnte genauso gut das andere Zürichseeufer sein. Er bringt der tablettensüchtigen, halbdementen, alkoholkranken Achtzigjährigen Blumen, begibt sich mit ihr im Taxi auf einen skurrilen Roadtrip zu seinen Kindheitsorten in der Schweiz und hat Wodkaflasche und Psychopharmaka dabei. Damit ist der für den Autor ungewöhnlich dialogreiche und relativ plotarme Erzählstrang von Eurotrash schon grob umrissen.
Literaturwissenschaftler dürften sich über Christian Krachts neuen Roman freuen, über all die autofiktionalen, biografisch anmutenden Fallstricke und literarischen, kunsthistorischen sowie Nazi- und Nachkriegsdeutschland-Bezüge, die der Autor zu einem subtilen Romangewebe spinnt, in dem die Spinne des Erzählers sämtliche Sicherheiten und Wahrheiten vereinnahmt. Das Feuilleton liebt sein manisches Spiel mit der Autofiktion und den Scheinrealitäten des echten und erfundenen Geschichtenerzählers. Das Werk des Schweizer Autors ist das wohl meist kritisierte, analysierte und erforschte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Stinkreich, piekfein, eklig und vulgär
Der fiktive Ich-Erzähler, der wie der Autor Christian Kracht heisst, beginnt seinen Roman mit «Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen». Er knüpft mit dieser Eröffnung an sein Romandebüt Faserland (1995) an, das in Sylt beginnt und in einem Boot auf dem Zürichsee endet. 25 Jahre und fünf Bücher später steht erstmals der Dialog mit der Mutter im Vordergrund. Der fiktive Kracht tut so, als wäre er selbst der Autor von Faserland und erzählt der Mutter Geschichten, weil sie das «immer am frohesten macht». Für Kracht-Fans sein bestes, ein begeisterndes, berührendes, witziges Buch, sein Meisterwerk. Auf andere wirkt die Fixierung auf das eigene Ich und sein Werk vielleicht affektiert und ermüdend.
Wieder begegnet der Leser einem wohlstandsverwahrlosten Erzähler-Snob, einem Dandy des 21. Jahrhunderts, der durch die Welt von Bunte und Gala jettet, luxuriöse Wohnsitze auf dem ganzen Globus besitzt, mit Geld und Markennamen um sich schmeisst und den die Dekadenz des Geldadels anödet. Diesmal reist der Protagonist nicht durch das zerfaserte Vaterland Deutschland, sondern mit der Mutter durch die Schweiz. Gleichwohl suchen ihn die Geister der Vergangenheit, Grossvater und Vater, heim.
Der Vater im Buch heisst wie im echten Leben des Christian Kracht ebenfalls Christian Kracht. Aus bescheidensten Verhältnissen in Hamburg-Altona stammend, wird er durch Gewinne aus Waffengeschäften unglaublich reich und steigt wie der reale Vater Kracht zur rechten Hand Axel Cäsar Springers auf. Traue, wer mag, den biografischen Parallelen, sie führen den gutgläubigen Leser zielsicher in die Irre. Täuschend echt im Vexier gespiegelt und subtil verzerrt wie alles, was an den realen Kracht junior und senior denken lässt.
Die Familie zerfällt, atomisiert sich, ist am Tiefpunkt angelangt. Die Mutter ist ein Wrack, kaputt und doch von grosser Kraft. Während der Sohn wegen ihr an Verstopfung leidet, entleert sie ihren Ennui bzw. Darminhalt in einen Stoma-Beutel am Bauch.
Arrogante Zürcher, rechtsnationale Schweizer
In Zürich, wo die Mutter in einem «deprimierenden weissen Faux-Bauhaus-Kasten aus den frühen Neunzigern» mit Seesicht residiert, spürt Erzähler Kracht nichts mehr vom «Geist von Joyce und des Cabarets Voltaire», sondern er stigmatisiert Zürich als «Stadt der Angeber, Aufschneider und der Erniedrigung», geldgierig, selbstherrlich, beengend, zu selbstsicher und saturiert. Die «Mutterstadt» ist Ausgangspunkt der Reise. Während sie aufs Taxi warten, fordert die Mutter den Sohn auf, ihr etwas zu erzählen:
«Wahrheit oder Fiktion?»
«Das ist mir egal. Entscheide Du.»
«Okay. Die Geschichte spielt hier, vor unserer Nase. Es, äh, es hatte in der Schweiz einen kleinen Rechtsruck gegeben, und dann noch einen, und dann, sechs Monate später, noch einen grösseren. Und die Neue Zürcher Zeitung und die Weltwoche und der Blick … waren zu den Sprachrohren der regierenden Partei geworden, deren Mitglieder begonnen hatten, kleine weisse Schweizer Kreuze auf rotem Grund am Revers zu tragen.»
«Oh.»
«Ja, und dann wurde der Neubau weiterer Moscheen verboten …
Die deutschen Zahnärzte und Chirurgen wurden allesamt ausgewiesen, als Krisengewinnler. Dann hatte man damit begonnen, Mundarttests durchzuführen, … und man grüsste mit dem Rütlischwur, zwei Finger und der Daumen hoch …
Verträge mit der Europäischen Union wurden aufgekündigt, das Schengenabkommen ebenfalls, und die Schweizer Grenzen wurden mit Zehntausenden Kilometern neuen Stacheldrahtrollen verstärkt …
und die Reformhäuser und die Coop und die Migros erhielten die Anweisung, … nur noch Schweizer Käse und Schweizer Fleisch und Wurstwaren, Eier und Landbrot (zu verkaufen) …
und ab dem Spätsommer gab es Hinrichtungen in der Schweiz».
«Du erzählst das alles so spannend, als ob es wahr wäre».
Auch in anderen Szenen bekommen Zürcher oder Berner oder Schweizer generell ihr Fett ab. Die schräge Geschichte oben erinnert übrigens an Charles Lewinsky’s «Der Wille des Volkes», einem lesenswerten Krimi, der in einer von einer national-populistischen Partei dominierten Schweiz der Zukunft spielt.
Humor an den Grenzen von Schein und Sein
Mutter und Sohn füllen ihre Reisekasse auf der Bank. Während sich zuhause ungetragene Nobel-Schuhe, Pelzmäntel und Hermès-Taschen stapeln, gleicht die Mutter einer verwahrlosten Obdachlosen: «Eine alte, angetrunkene, zerschrammte Frau mit fettigen Haaren und blutunterlaufenen Augen, die sich am Rollator festhielt», aber ihr Geld gewinnbringend in deutschen Waffensystemen und schweizerischen Molkereien angelegt hat. Trotz «ihrer fehlenden Insignien der Bourgeoisie» wird sie in der Bank behandelt wie eine Madame. Für die Reise hebt sie 600’000 Franken ab und leert das Bündel Tausendernoten in eine Plastiktüte.
Nun beginnt die Reise im Taxi, die die beiden an Krachts Geburtsort Saanen und weitere Kindheitsorte in der Westschweiz führt, bis sie in der geschlossenen Psychiatrie in Winterthur endet. Unterwegs nähern sich die beiden an.
Sie reisen innerlich zurück zu Erfahrungen in der Vergangenheit, die sie teilen, in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein. Der Ton des Ich-Erzählers wird mehr und mehr versöhnlich, bis es am Ende «eine sehr schöne Reise» mit der Mutter wird. Die meint übrigens, der Sohn solle endlich ein gutes Buch schreiben, wie Flaubert oder so. Hat er doch. Einen echten Kracht.
Christian Kracht
Eurotrash
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021
Hardcover
224 S., CHF 31.90
ISBN 978-3-462-05083-7
«Sophie Passmann: Komplett verzogen»
Sophie Passmann befasst sich in ihrem neuen Buch «Komplett Gänsehaut» mit ihrer eigenen Generation. Als verwöhntes «westdeutsches Mittelstandsgirl» geht sie auf die Urban Hipsters los.
Die 27-jährige Entertainerin, Bestsellerautorin und Radiomoderatorin Sophie Passmann macht sich in Komplett Gänsehaut Gedanken über ihre Generation und zieht mächtig drauflos. Sie mosert über «Umziehen ist wie Abbrennen», Risotto kochen (mit Milchreis), die nostalgische Verklärung der Jugend im Nachhinein oder «Arschlöcher», die wie sie – sie spricht häufig von wir oder man – Rezepte aus dem SZ-Magazin abfotografieren.
Der Prolog ist ein angestrengtes, oberflächliches Gebrabbel, die Sätze wollen nicht enden, Poetry-Slam-Modus eben, und so geht es weiter in den drei Kapiteln des essayartigen Werks. «Die Wohnung», «Die Strasse» und «Die Stadt» werden ausgekehrt mit dem Besen der Ironie und dem Staubwedel des Zynismus. Bis ins Schlafzimmer hinein arbeitet sie sich an Themen wie Matratzen, Männlichkeit, «Frotteebettwäsche mit so einer besonderen Muttersöhnchen-Textur», im Elternhaus ein Jahrzehnt lang weichgespült, und dazugehörigen «Dekokissen-Mädchen» mit «weissen Kommoden mit Lichterketten an den Vintageknäufen» im Schnellgang ab. Die Bilder haben Kraft, sind aber von kurzer Wirkung, da sie auf der Oberfläche bleiben und schon der nächste Jammereinfall ausgespuckt werden will.
Im Sumpf der Bücherregale
Tiefer wühlt sich Passmann in den Sumpf, den Bücherregale darstellen, hinein. Männer ohne Bücher sind nicht gut, Männer mit Büchern auch nicht. Wahrscheinlich stünden die Falschen drin, und ganz schlimm, womöglich Werke von David Foster Wallace. Empfehle ein Jungmann den US-amerikanischen Kultautor konspirativ als Geheimtipp, sei das so, wie wenn man frage, «Hey, kennst du schon die Rolling Stones?». Das seien dieselben heimlich hypermaskulinen Männer, die auf das Gendern in ihrer Bachelorarbeit doch lieber verzichtet hätten und einfach lieber einen Porsche leasen sollten.
«Bücherregale sind auch einfach irre anstrengend, weil sie immer etwas wollen vom Raum.» Oder vom Besucher. Dabei sei es «heute einfach nicht mehr so wichtig, gebildet zu sein, vielleicht ist mittlerweile auch einfach deutlich geworden, dass Bücher von Nazis, Frauenhassern, Straftätern und so weiter zu lesen kein Beweis ist für die Intellektualität». Im nächsten Satz zieht sie das Fazit, «Weltliteratur ist nichts anderes als Männer, die sich nicht kurz fassen wollen,» und bringt Thomas Manns Zauberberg als Beispiel. «Rasend vor Eifersucht» sei sie auf diese Form des Selbstbewusstseins, die man nur habe, «wenn man verzogen wurde, wenn man als Kind wirklich für alles gelobt wurde». Sonst könne man nicht tausend Seiten über einen schlechten Kurort schreiben.
Verzogen und selbstbewusst
Verzogen und selbstbewusst, das passt auf das komplett verwöhnte Komfortzonengirl, als das sich Passmann in Komplett Gänsehaut gibt. Dessen Horror ist das Erben. «Ich fahre selten in die Stadt, aus der ich komme, in das Haus, in dem ich gross geworden bin, weil ich es nicht ertrage, mir den ganzen Krempel anzuschauen, den ich irgendwann erben muss.» Lustig ist das manchmal schon, wenn man noch jung ist und sich hinterfragt, bin ich auch so? Es mag ja sein, dass hier nicht die reale, sondern eine fiktive Autorin spricht. Aber das konturlose Zetern und Lamentieren macht diesmal noch keinen Wumms und auch nicht wirklich Lust, zu ergründen, wieviel davon die echte Passmann ist.
Sophie Passmann,
Komplett Gänsehaut
Kiepenheuer & Witsch 2021,
192 S., CHF 23
ISBN: 978-3-462-05361-6
«Simone Meier: Reiz der Liebe und des Haarsprays»
Simone Meier ist in ihrem neuen Roman «Reiz» der Liebe in vielen Facetten auf der Spur, von der Jugend bis ins Alter. Ausnehmend reizvoll und spritzig.
Wer Lust an Larmoyanz und Opferrollen hat, lege dieses Buch sofort aus der Hand. Simone Meiers dritter Roman «Reiz» ist nichts für Menschen, die sich in Selbstmitleid suhlen. Beziehungsfragen der Generation 50 plus stehen im Mittelpunkt, flankiert vom Liebesleid von Teenagern, der «Fleisch gewordenen Übertreibung». Die zentralen Fragen sind, «ob man Talent zum Alleinsein hat oder nicht», wenn man kein Beziehungsmensch ist, und wie man in Ruhe alt wird, «die letzten Stürme der hormonellen Schlechtwetterlage» aushält und «sich dann innerlich an den mild besonnten Strand nach der Apokalypse des Klimakteriums» zurückzieht.
Die Hauptperson Valerie ist wie Autorin Simone Meier eine erfolgreiche Zürcher Journalistin mit Biss, Witz und Sarkasmus. Der Leser kennt sie schon aus früheren Werken. Nun ist sie Mitte fünfzig. In einem Alter, in dem «man in ihrer Branche gern entlassen wurde, und es für viele keine Rückkehr in den Job mehr gab… Valerie kannte genügend Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt auf schlecht gestalteten Medien-Blogs für Pensionisten tummelten und dort Verschwörungstheorien, Naturbetrachtungen oder dem Selbstmitleid frönten.» Für die selbstbestimmte Valerie kommt das freilich nicht in Frage.
Quer durch alle Schichten und Altersstufen
Meier konjugiert das Thema Liebe und sexuelle Anziehung in verschiedensten Facetten in ihrem Gesellschaftsroman durch. Da ist neben Valerie zunächst der Starschauspieler F., der «Solitär in ihrer Sammlung», der wie Valerie mit dem Plan der grossen Liebe abgeschlossen hatte. «Was beiden blieb, war ihre stille See aus Vertrauen». Dann ist da F.s Sohn Luca, «das Lämmchen», der das Leben und die Liebe vor sich hat. Ihm zur Seite gestellt werden u.a. die Unterschichtsgöre Kia, die sich zu wehren und zu kämpfen weiss, und Merle, das Oberschicht-Pferdemädchen, das Luca an «eine Kreuzung aus Mädchen und Fohlen, eine Kentaurin», denken lässt – beide moderne, kleine Amazonen. Merles Blowjob ist Lucas erster Sex. An dem stimmte nichts: «Es war eine Million von kleinsten Reizen, die sich über ihm entluden, und es war dem Prickeln, Brennen, Anschwellen während eines Allergieanfalls nicht unähnlich.»
Ausserdem treten auf: Lucas lesbische Hippiemutter Alex, «ein Einhorn von Planet Rainbow» und deren Partnerin, weitere Mütter, Grossmütter, Fabrikarbeiterinnen – böse, böse, «eher Klumpen als Menschen» – und jede Menge Ex- bzw. Noch-Liebhaber der attraktiven Valerie, die wahrlich keine Kostverächterin ist. Dabei könnte ein jeder für eine andere Spielart der Liebe stehen. Der letzte aus Valeries Sammlung ist der nicht unsympathische Toyboy Teo, bei dem es «wirklich der Porsche gewesen (war), der sie als erstes erotisiert hatte.»
Ein Buch, das Frauen und Männer mit Humor zum Lachen bringt, auch in ernsten Episoden. Die pointierte Charakterisierung der Figuren ist Simones Meiers Stärke und voll aus dem Leben gegriffen. Manche Typen provozieren kraftvolle Bilder und spöttische Vergleiche. Wenn einer etwa «treuherzig wie ein Golden Retriever unter Männern» blickt oder «saftlosem Lauch» bzw. «ungebackenem Toastbrot» gleicht, wird Meiers Feder besonders spitz. Sie schiebt Fragen wie diese hinterher: «Besass er ein besonders maskulines Accessoire, einen Kugelgrill zum Beispiel?».
«Von einem gar nicht netten Mann»
Kurz, man liest sie gern, die Geschichten, die das Leben dem privilegierten «Vally-Baby», «alten Sack F.», «Lämmchen» Luca oder Katzen-Mädchen Kia schrieb und amüsiert sich. Locker-flockige Popkultur mit Tiefgang, leicht wie ein Soufflé, prickelnd wie Prosecco, würzig wie Salzkristalle in Karamellschokolade. Ohne bitteren Beigeschmack, selbst wenn es unter die Haut geht. Beim Thema sexuelle Übergriffe etwa, einem grandiosen Kapitel des Buchs.
Die Szene spielt in einem Zürcher Hamam. Die junge, noch nicht abgebrühte Valerie und ihre damaligen WG-Genossinnen tauschen sich über männliche Übergriffe aus, als sie die Narbe auf dem Oberschenkel einer dänischen Gaststudentin sehen. «Das?», sagte die Dänin. «Ist von einem Mann, einem gar nicht netten Mann.» – «Von denen gibts viele», sagte eine andere. Es entspann sich ein Gespräch, es lag kein Schmerz darin und keine Klage, einzig ein Staunen über die Unausweichlichkeit der Dinge. …, ihre Gesprächsfetzen formten sich zu einem Chor, der vom heissen Stein hoch und in die Kuppel stieg. «Und du?», lautete der Refrain. … «Ich habe Pfefferspray dabei, eine Trillerpfeife, ein …» – «Haarspray ist besser. Damit kommt ihr durch alle Kontrollen. Mit Pfefferspray nicht.» – «Stimmt.» – «Und der Typ riecht tagelang danach. Wenn einer kommt und seine Jacke stinkt nach Elnett, dann weißt du Bescheid.»
Was bleibt, ist Freundschaft
Der rote Faden in diesem erfrischenden Reigen der Reize ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Alter. «…überhaupt sei das Leben doch so, man sei am Anfang frei und am Ende und dazwischen stecke man in einem Flaschenhals aus Verpflichtungen und Konventionen», meint F. Der junge Luca fragt sich, wie es sich in einem alternden Körper anfühlt und ob die Seele mit ihm altert. Die Autorin gibt eine versöhnliche Antwort: «Sie (F. und Valerie) kannten einander schon so lange, dass sie füreinander jung blieben…. Es war doch so: Gesichter, denen man immer wieder begegnete, alterten entlang dem eigenen. Sanfter. Nicht so brüsk.»
Nebenbei erfährt man einiges über das Rüstzeug der klassischen Reporterin, ihren unausweichlichen Berufszynismus und die Fallstricke des Schreibens, wenn sich Fakten, Fiktion und persönliche Ebene mischen. Valerie nimmt am Schluss Luca als Praktikanten unter ihre Fittiche. Den Rat, den sie ihm gibt, «Fühle deinen Stoff. Du bist nichts als der Trichter, der ihn kanalisiert.», setzt die Kulturjournalistin des Jahres 2020 in «Reiz» so temporeich und lebhaft um, wie einst die Amazonen kämpften.
Simone Meier, geboren 1970, ist Autorin und Journalistin. Nach einem Studium der Germanistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte arbeitet sie zunächst als Kulturredakteurin, erst bei der WochenZeitung, dann beim Tages-Anzeiger, seit 2014 bei watson. Sie hat diverse Preise und Stipendien gewonnen. Bei Kein & Aber erschienen ihre Romane Fleisch, Kuss und zuletztReiz. Simone Meier lebt und schreibt in Zürich. 2020 wurde sie zur »Kulturjournalistin des Jahres« gewählt.
Simone Meier
Reiz
Kein & Aber, Zürich 2021,
Hardcover, 240 S., CHF 28
ISBN: 978-3-0369-5839-2
«Backstage mit Charles Lewinsky: Sind Sie das?»
Charles Lewinsky spürt in seinem neuen Buch «Sind Sie das?» der Verschmelzung von Fakten und Fiktion nach und überprüft, wieviel Persönliches sich in seine Romane hineingeschmuggelt hat. Eine amüsante Revue voller Esprit, spritziger Anekdoten und Einblicke in die Schweizer Populärkultur der letzten 50 Jahre.
Die Frage, wieviel Persönliches in einem Buch steckt, kennen viele Schriftsteller. Die Verwechslung von Protagonist und Autor geschieht häufig, wenn nicht gerade Germanisten lesen. «Es gibt ja auch genügend Autoren, die in wechselnden Verkleidungen immer nur über sich schreiben», urteilt Charles Lewinsky. Die aktuelle Schweizer Literatur gibt ihm recht, die Frage drängt sich förmlich auf: Wieviel Evelyn Braun steckt zum Beispiel in «Die Interviewerin», wieviel Simone Meier in «Reiz», wieviel Suter und Stuckrad-Barre in «Alle sind so ernst geworden» und, erst recht, wieviel echter Kracht in «Eurotrash»? Nun widmet sich der schon in jungen Jahren «lesesüchtige» Schweizer Erfolgsautor, Liedtexter, Volksmusikspezialist, Drehbuch- und Hörspielautor, Theatermann und Fernsehredakteur der Frage «Wieviel von mir steckt in meinen Büchern?» und durchforstet diese nach privatem «Schmuggelgut». Sind Sie das? ist ein Buch, das schon lange in ihm rumort habe und er sich zum Fünfundsiebzigsten in der feierfreien Coronazeit leiste, wie er schreibt.
Den Autor wurmt’s
«Die Hauptfigur Ihres Romans ist ein Pädophiler. Sind Sie das?» Diesen Stachel setzte vor mehr als zehn Jahren ein Gymnasiallehrer bei einer Lesung von Johannistag Lewinsky ins Fleisch. So tief, so dreist, dass der ihn nicht stecken lassen wollte. Je nachdem, welche Interessen er den Protagonisten seiner Bücher zuschrieb, müsse er demzufolge etwa ein ausgesprochen modebewusster Mensch, frommer Bibelkenner oder Spezialist für Geigenbau sein, stellt Lewinsky fest. Was der Wirklichkeit nicht näher komme als die Behauptung, er würde nächstens im Opernhaus in Schwanensee mittanzen. Ein Theaterkollege habe den Gap zwischen Fiktion und Wirklichkeit im Fall der Kleiderfrage auf den Punkt gebracht, als er bemerkte: «Du kannst tragen, was du willst – dir steht nix.»
Chronologisch arbeitete sich Charles Lewinsky im Jahr Eins der Pandemie also durch seine 14 Romane auf der Suche nach Versatzstücken aus dem eigenen Leben. Das Experiment ergab, dass die jüdisch-orthodox geprägte Kindheit und Jugend den Stoff liefern, der sich am stärksten in seine Dichtung drängt, dass der eigenen Erinnerung nicht zu trauen ist und die wichtigsten Menschen im realen Leben bis jetzt nicht Eingang ins Werk finden.
Andererseits haben Lewinskys berufliche Erfahrungen durchaus Niederschlag in seiner Literatur gefunden. In einer Fülle von Anekdoten und komischen Szenen begegnet man infolgedessen Stars und Machern der Schweizer und deutschen Unterhaltungsindustrie quasi hinter den Kulissen. Als Insider plaudert sich Lewinsky mit gewohntem Schalk und Charme durch 50 Jahre Popkultur, Showbusiness und Literaturbetrieb. Angesichts seiner abenteuerlichen, schillernden Karriere wirkt die Behauptung, «Das eine oder andere meiner Bücher mag vielleicht interessant sein – mein Leben ist es nicht» als Paarung von Koketterie und Ironie, wie so manches andere Geständnis im Buch.
«Abenteuerurlaub auf der Tastatur»
Eine Autobiografie sollte Sind Sie das? nicht werden, keinesfalls, erklärt der Autor, und ist es «zum Glück» auch nicht geworden. Der Leser kann sich das Leben des Geschichtenerzählers aus dessen autobiografischen Geschichten selbst zusammenreimen. Vita und Arbeiten inklusive Inhaltsangaben der Romane lassen sich übrigens übersichtlich geordnet auf www.lewinsky.ch nachschlagen.
Aber wer denkt schon an Leser, wenn das Buch ohnehin nur für die Enkel bestimmt ist, und nicht für Literaturseminare? Solche Aussagen machen stutzig. Lewinsky wäre nicht Lewinsky, wenn nicht genau darin ein Wert des Werks läge. Und ja, es funktioniert als praxisbezogenes Seminar für angehende Schriftsteller. Gute Ratschläge mit anschaulichen Beispielen finden Autoren in spe zu Hauf: Vom (gar nicht) lapidaren «Schreiben lernt man beim Schreiben» bis zur «Suche nach der jeweils richtigen, zur Geschichte passenden Sprache», die für Lewinsky «fast zum wichtigsten Arbeitsschritt» geworden ist. Einem Mentor gleich nimmt der vielfach ausgezeichnete Sprachartist und Romanautor Zaudernde an die Hand und macht vor allem eins: Mut. «Dass ich mit der Arbeit an einem Buch beginne, ohne genau zu wissen, wo mich die Geschichte hinführen wird – das ist für mich eine ganz normale Arbeitsweise.» Oder: Wenn’s stockt, «gehe ich oft in den Garten und jäte meine Gemüsebeete, bis mir dann endlich der erlösenden Einfall kam». Und welch wundersamer Balsam für wunde Dichterseelen, als vom grossen «Friedhof der nicht lebensfähigen Projekte, der sich hinter dem Haus jeden Schriftstellers findet» die Rede ist.
Man lernt, aus dem Fundus des Erlebten frei zu schöpfen: «Was man erlebt und was man für ein Buch erfunden hat, lässt sich im Nachhinein nicht mehr trennen.» Und weil es Lewinsky «beim Schreiben gern spannend» hat, freuen wir schon auf die nächsten Geschichten, die er bei seinem «Abenteuerurlaub an der Tastatur» entdecken und zu Papier bringen wird.
Ach, und falls Sie seine Antwort auf die Frage des Gymnasiallehrers jetzt schon wissen wollen: «Nein, der Pädophile aus Johannistag, das bin nicht ich.»
Charles Lewinsky,
Sind Sie das?
Diogenes, Zürich 2021
288 S., CHF 32.
ISBN 978-3-257-07111-5

