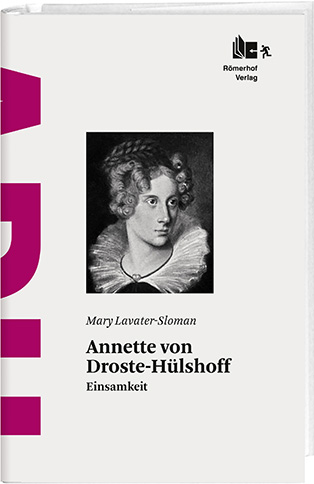

Annette von Droste-Hülshoff, Bild PD
«Annette von Droste-Hülshoff: Einsamkeit»
Von Mary Lavater-Sloman
Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) war nicht nur eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen und Dichterinnen ihrer Zeit, sondern auch passionierte Musikerin und Komponistin. Werke wie »Die Judenbuche« oder »Der Knabe im Moor« sind Klassiker der deutschen Literatur. Facettenreich und wortgewandt zeichnet Mary Lavater-Sloman das Bildnis einer hochbegabten und ausserordentlich sensiblen Frau, deren kränkelnder Körper stets widerspiegelte, wie sehr das Unverständnis ihrer Zeit und ihre unvollkommenen Liebesbeziehungen auf ihr lasteten. Literatur & Kunst bringt exklusiv einen Auszug aus der Biografie.
Doch gerade diese Konstitution wirkte prägend für das Schaffen der begabten Dichterin, das trotz Schwermut von bezeichnender Klarheit und Fassbarkeit zeugt. Mary Lavater-Sloman verleiht ihrer Biografie wie gewohnt mit einfühlsamer und fantasievoller Wortgewandtheit lebbare Substanz. Ein Nachwort der NZZ-Journalistin und Droste-Kennerin Beatrice Eichmann-Leutenegger würdigt die Biografie, die am 29. September im Römerhof-Verlag erscheint.
Buchauszug
5. Kapitel
Und dann fielen die Blätter, die Heidenebel stiegen allabendlich, die Herbststürme begannen und schoben dunkle Wolkenbündel nah über den Mooren dahin; es ächzte in den Eichen, nachts schrien die Käuzchen wie verlassene Kinder, und die Fledermäuse blinzten, an das Fensterkreuz gekrallt, in die Zimmer des Schlosses; die weiten Gänge wurden kälter und kälter, und in diesem Kriegsjahr brachten nicht einmal die Jagden das Geräusch von Lachen, Rufen, Hundegebell und frohen Stimmen in die Eintönigkeit des Lebens hinter dem Weiher.
Nein, jetzt war keine Zeit für Feste und Jagden; das ganze Land hält den Atem an; allenthalben ziehen siegreiche Kosakenscharen durch die Gegend. Für kurze Zeit hatte Tschernischeff schon in Kassel residiert und das Königreich Westfalen für aufgelöst erklärt, aber kaum war der erste frenetische Jubel verklungen, da war Jérôme auch schon zurückgekehrt, weil der Russe weiterziehen mußte.
In der Mitte des Oktober 1813 ist der Westfälische Moniteur voller französischer Siegesnachrichten; man kennt die Lügenmären nun nachgerade! Was ist wahr an ihnen? Die Spannung ist ungeheuer. Man weiß, daß im Osten Deutschlands etwas geschieht. Hat der Kaiser nochmals gesiegt? Ist die nahe Befreiung abermals nichts als ein Traum?
Endlich, endlich sickert die Wahrheit durch. Napoleon ist in einer Schlacht, in der alle Völker gegen ihn standen, besiegt worden; da verfliegt unter einem einzigen starken Windstoß der Alpdruck einer Weltherrschaft wie der Schrecken einer Nacht; nun aber ergreift ein übermütiges Aufatmen alle Volksschichten, und als der 27. Oktober heraufgedämmert ist, zeigt es sich, daß Jérôme und sämtliche Franzosen heimlich im Dunkeln Kassel verlassen haben.
Die Jubelbotschaft dringt rasch bis in die hinterste Provinz. Welch ein beglückender Herbst liegt über dem westfälischen Lande. Clemens August triumphiert, daß schon vor Jahren die Bauern mit ihren Seheraugen diese Zeit vorhergeschaut haben. Im Liber Mirabilis hatte er alle Prophezeiungen aufgeschrieben.
Es ist zehn bis zwanzig Jahre her, daß die Leute in Heide und Moor von silbernen Reitern sprachen, mit silbernen Kugeln auf den Köpfen, von denen Roßschweife flattern. Das sind die französischen Kürassiere. Andere hatten wunderlich aufgeputztes Soldatengesindel gesehen, das auf Pferden wie Katzen über Hecken und Zäune fliege, in der Hand eine lange Stange mit einem eisernen Stachel daran. Die Kosaken hatten die Bauern geschaut, die gefeierten Befreier.
Und in dieser Zeit, da alles aufgeregt glücklich ist, sinkt Annette immer tiefer in eine krankhafte Schwermut; sie kann den Verlust von Katharina nicht verschmerzen. Wie verloren treibt sie im Ansturm ihrer Gefühle, Ideen und Wünsche dahin. Gefühle einer nie gekannten Verlassenheit, Ideen zu Werken, die sie schaffen möchte, sei es in der Musik, sei es in der Dichtkunst, Wünsche nach Aussprache von Herz zu Herz, Wünsche nach einem Gefäß, in das sie all ihre Unruhe, ihr Sehnen ergießen kann. Vorbei das Schlendern durch das blühende Land mit der angebeteten Freundin, vorbei das Träumen am Waldesrand oder auf einem Heidehügel; nun muß sie Sonne, Mond und Sterne allein betrachten, ohne daß ihr und der Gefährtin Verse über die Lippen drängen. Wenn Jenny abends mit ihr vom Fenster das Wolkenspiel um die sinkende Sonne betrachtet, so legt sie den Strickstrumpf nicht aus der Hand; Werner verhöhnt ihr geduldiges Warten, bis der Mond zwischen den Eichen hindurchwandelt, und Fente, der blasse, geliebte Knabe, ist so scheu, daß er in verzauberten Momenten kein Wort über die Lippen bringt.
Annette ist jung und überschwenglich; der Kummer um die verlorene Freundschaft steht wie ein Berg vor ihren Augen und verdeckt ihr die ganze Welt, und doch ist gerade jetzt nicht nur ihr Heimatland, nein, ganz Europa von einem bösen Traum erwacht und rüstet sich, einen neuen Tag zu beginnen.
Onkel Werner von Haxthausen ist in Wien auf dem Kongreß; ein Widerhall des großen Lebens in Politik und Geselligkeit dringt bis nach Hülshoff, wenn er gelegentlich in der Heimat weilt. Staunend hört man von Männern, die die ganze Landkarte Europas verändern, und von Frauen, die klug und willensstark die Fäden des Geschehens in Händen halten. Menschen, die leben und von einem Land in das andere reisen, als sei es nichts.
Werner von Haxthausen sprach ganz ruhig davon, den Orient bereisen zu wollen. Alle Welt wollte jetzt reisen. Mit dem Schiff um die Erde, wer ganz tollkühn war, zu Wagen, wer Geld hatte, und als Wanderbursche, wer nur seine festen Schuhe und einen Stecken besaß. Aber das waren Männer, für die es keine Schranken in der Welt gab, diese Glücklichen, denen alles erlaubt war!
Stärker denn je peinigt das Fernweh Annettens ungestüme Seele. Wie in einem Bannkreis drehte sie sich jahraus, jahrein zwischen Hülshoff, Münster und den Gütern der Verwandten im Kreise. Nichts, nichts kannte sie; weder Kassel noch Göttingen, weder Köln noch Bonn, und doch wirkten und studierten dort ihre Onkel und Vettern und Freunde. Sogar Sprickmann ist auf seine alten Tage in die Ferne gezogen, unermeßlich weit fort, bis nach Breslau; das ist die Trennung für alle Zeit.
Annette wird immer magerer, immer blasser, oft scheint es ihr selber, sie hätte die Auszehrung, aber sie stürmt trotzdem, wie sie es schon als Kind getan, in die Heide hinaus, so weit ihre Füße sie tragen können; ist sie dann auf dem Heimweg in völlige Erschöpfung geraten, so kehrt sie in dem kleinen niedri- gen Bauernhaus ihrer Amme ein, die dort mit ihrem Mann und Annettens Milchbruder wohnt.
Kathrin Pettendorf fragt nicht und schilt nicht; sie ist eine Frau Ende der Dreißiger, etwas jünger als Annettens Mutter, klug auf Bauernart, voller Herzenstakt und von unendlicher Liebe zu ihrem »Töchterchen« erfüllt, aber von der mühsamen Arbeit auf dem Felde früh gealtert. Ist sie zu Hause, wenn Nette an ihre Türe klopft, so läßt sie das Kind in ihrem einzigen Lehnstuhl ruhen, gibt ihr warme Milch, trocknet ihre Schuhe und Strümpfe und schickt es dann schnell nach Hause, damit die Frau Mama nicht schelte.
Therese ist aber nicht mehr so rasch im Zorn wie in Annettens Kinderjahren; sie ist viel zu klug, um nicht zu begreifen, daß in ihrer absonderlichen Tochter mehr Kräfte stecken als in ihren drei andern Kindern zusammengenommen; sie sorgt sich um Annette und möchte sie so zurechtschleifen, daß sie in das vorgezeichnete Leben ihres Kreises hineinpaßt; es ist kein Glück, aus dem Ring seines Daseins herauszufallen. In Güte und Strenge versucht sie, es Annette klarzumachen. Sie muß begreifen, daß Frauen und Mädchen in das Haus gehören! Was sollte aus der Bewirtschaftung der großen Schlösser und Güter werden, wenn die Frauen in der Welt umherreisten, anstatt dafür zu sorgen, daß genügend Wolle und Leinen gesponnen wurde, zu berechnen, wieviel Salz und Zucker, Kaffee, Tee und Gewürze angeschafft werden durften, wieviel Eier eingelegt, Obst gekellert, Bier gebraut, Korn zu Mehl gemahlen werden sollte. Was alles an Fleisch gepökelt, gedörrt, gesalzen werden mußte und wie viele Schinken und Würste in die Räucherkammer gehörten. Und immer gibt es neue Kleider und Wäschestücke zu nähen, Bettwä-sche zu säumen, und wenn sich dann noch zehn bis fünfzehn Kinder in den Burgen und Gutshäusern tummeln, wie es sehr häufig ist, Krankheiten kuriert, die Dienstboten überwacht und Besuche empfangen werden müssen, dann waren die zwölf Stunden des Tages viel zu kurz für die Hausregentin. Annette sollte möglichst bald einen Gatten erwählen, dann würde ihr das sinnlose Spazierenlaufen, das Singen und Verseschmieden schon vergehen.
Nach solchen Bußpredigten kann Annette kaum an sich halten, vor der Mutter nicht ihre ganze innere Verzweiflung auszubreiten, aber sie schweigt in ihrer strengen Selbstdisziplin und versucht, sich ganz den weiblichen Hausgeschäften zu widmen, aber es gelingt ihr nur für Tage, dann schweift sie wieder ab in ihr eigenstes Leben, das weder sie beglückt noch die andern.
Einmal sendet sie ihrem lieben Sprickmann ein langes Gedicht. »Unruhe« nennt sie es und schließt mit den Versen:
O ich möchte wie ein Vogel fliehen,
Mit den hellen Wimpeln möcht ich ziehen,
Weit, o, weit, wo noch kein Fußtritt schallte,
Noch kein Schiff durchschnitt die flücht’ge Bahn.
Und noch weiter, endlos, ewig neu
Mich durch fremde Schöpfungen voll Lust Hinzuschwingen, fessellos und frei –
O, das pocht, das blüht in meiner Brust.
Rastlos treibt’s mich um im engen Leben,
Und zu Boden drücken Raum und Zeit, Freiheit heißt der Seele banges Streben
Und im Busen tönt’s Unendlichkeit.
[…]
Fesseln will man uns am eignen Herde,
Unsre Sehnsucht nennt man Wahn und Traum,
Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde,
Hat doch für die ganze Schöpfung Raum!
Annettens Geist war in diesen Jahren ihrer Jungmädchenzeit übermäßig rege. Immer noch kämpfte sie mit ihrem Rittergedicht: »Walter«, und seit kurzem hatte sie ein Trauerspiel »Bertha« begonnen, in das sie all ihren jugendlichen Kummer und ihre innere Unrast ergoß. »Schmerz verbreiten und erdulden, ist mein Los hienieden«, sagt sie resigniert durch den Mund ihrer Heldin.
Annette wußte sehr wohl, wie unzulänglich ihr Werk wurde, und doch sind einzelne Verse kraftvoll und echt, aber nur, wenn sie ihrem eigenen Erleben entsprungen sind. Einmal wird die Heldin von ihrer Schwester ermuntert, sie solle ihre Unrast mit weiblichen Handarbeiten besänftigen, aber »Bertha« fährt auf:
Bei deinem farbigen Gewebe kann
Ich keine Ruhe finden; ganz allein
In meinen stillen Träumen liegt mein Glück.
Was sind einzelne wahr empfundene Gedanken? Annette ist schon so weit Dichterin, daß sie ihre Unfähigkeit fühlt, den Stoff lebendig zu machen, und doch fährt sie fort, mit ihrem Werk zu ringen, aber es will und will nicht glücken. Hin und wieder fleht sie ihren alten geliebten Sprickmann an, er solle mit männlicher Härte und Klarheit kritisieren, das Urteil der Frauen sei Gewäsch.
Nur ihre Mutter ist von erfrischender Offenheit. Wie Annette in ihrem Rittergedicht »Walter« einen alten Freiherrn Selbstmord begehen läßt, verbietet Therese dieses Ende. Ein Freiherr nimmt sich nicht das Leben! Also gefälligst eine andere Lösung, und Annette, tief im Bann ihrer Mutter, bringt den alten Mann wieder zum Leben und läßt ihn nochmals, aber standesgemäß umkommen.
Dieses gehorsame Fabrizieren drückt jedoch auf ihr künstlerisches Gewissen und legt sich auch, je mehr sie versucht, verwirft und wieder beginnt, lähmend auf ihr Gemüt. Es ist ja dieses Wollen und nicht Können, das Schwert im Herzen, das keinem wahren Dichter erspart bleibt. Junge Menschen haben oft eine große Leichtigkeit, Verse zu machen, zweifeln meistens gar nicht an ihrem Talent und sprudeln unbefangen Gutes und Schlechtes hervor, aber Annette litt schon mit siebzehn Jahren alle Qualen des von den Göttern angerührten Menschen, der stets das Äußerste und Höchste erstrebt und nie von der eigenen Leistung befriedigt ist.
Sie hatte nun zwar gelernt, unter den Augen der Ihren Beherrschung zu üben, immer wieder versuchte sie, artig dazusitzen und zu stricken, aber es langweilte sie maßlos, wie sie Anna von Haxthausen gestand; sie fügte sich auch, wenn man ihr verbot, nach Noten zu spielen, weil ihre Augen immer schlechter wurden; sie ging gehorsam nur bis zum nahen Flüßchen und stand dort auf einem großen Stein, ihr verzerrtes und zerfließendes Bild betrachtend, um bald wieder heimzukehren, so als sei sie an einer langen Kette angeschlossen wie ein Hofhund.
Sie schwieg und lächelte, konnte sogar mit ihrem Sinn für Komik eine ganze Gesellschaft zum Lachen bringen, aber in ihrem Herzen war sie bedrückt und sehr allein. Wie oft trauerte sie den Stunden nach, da sie mit Kathinka über die Heide gewandert und sie ihr Herz vor der geliebten Freundin aufgetan hatte, wie vor einem zweiten Ich.
Nur einmal erhielt sie Nachricht von ihr, seitdem sie als Frau Schücking in Clemenswerth bei Sögel lebte, ein Jahr nach ihrer Eheschließung, als sie ein Söhnchen geboren hatte. Levin heiße es, so schrieb sie; seitdem nie mehr ein Wort.
Die Zeiten einer gewissen Ruhe kamen nur selten für Annette. Nächte und Nächte ließ eine kaum zu tragende Rastlosigkeit sie schlaflos liegen; besonders bei Mondschein waren ihre Nerven übersensibel; es mag an einer Ostern in diesen Jahren gewesen sein, daß sie sich, ihrer festen Behauptung nach, selber vom Fenster aus im Freien wandeln sah und angeblich auch von den Dienstboten, die draußen die Osternacht feierten, gesehen wurde. Verwandte, die zu Gast waren, haben auch bezeugt, daß sie, ihrer selber unbewußt, nachts in den Gängen des Schlosses wandelte und sehr vorsichtig geweckt werden mußte; überdies gibt ein Bekannter dieser Jahre, Fritz Beneke aus Hamburg, dem Annette in Bökendorf begegnete, ein Geständnis, das sie ihm gemacht, in seinem Tagebuch mit den Worten wieder:
»Ihr erscheint sehr häufig im Traum ein Gesicht, nicht widrig, aber stets das nämliche, sie mit Grauen erfüllend. Es gibt ihr stets Rat zu zaubrischen Versuchen, sagt ihr Dinge vorher, die stets eingetroffen, ja beurkundet sich auf die unwidersprechlichste Weise durch kleine Gaben der sonderbarsten Art. Anfangs hat sie sich verleiten lassen, Versuche zu machen, die auf überraschende Weise gelingen. Endlich aber hat sie sich zu Gott gewandt, und lange schon ist der dunkle Geist gewichen, der nun nur noch zuweilen anpocht; itzt fühlt sie sich auch körperlich wohler.
Ich würde nicht fertig werden, wenn ich nur die Hälfte hier- her setzen würde von den Geständnissen, die sie mir machte … Ich war stark beschäftigt mit der Zauber-Jungfrau, die – ich gestehe es – einen tiefen, vielleicht nie verlöschenden Eindruck auf mich hinterlassen hat.«
Die sichtliche Verbundenheit Annettens mit der Geisterwelt, das Dämonische in ihr, muß so stark zum Ausdruck gekommen sein, daß unter den Bauern der Umgegend der Glaube entstand, das Fräulein aus dem Schlosse könne »Wasser treten«, man hätte gesehen, wie es trocknen Fußes den Weiher überschritten habe.
Annette war nicht glücklich über die wahren und die vermeintlichen Gaben, die sie besaß, so wenig wie irgendeiner der »Blassen im Heideland«, die zu dem »gequälten Geschlecht der Seher der Nacht« gehörten. Wenn wenigstens das Musizieren ihr Herz entlastet hätte! Auch über ihr Klavierspiel fällt Fritz Beneke, der Beobachter dieser Jahre, ein treffendes Urteil:
»Ihr Spiel ist fertig, etwas heftig und überschnell, zuweilen etwas verworren. Mit der größten Leichtigkeit spielte sie das Hauptsächlichste des Don Juan, und andere Hauptsachen, durch. Ihre Stimme ist voll, aber oft zu stark und grell, geht aber sehr tief und ist dann am angenehmsten. Wirklich komponiert sie itzt an einer Oper.«
Annette selber läßt in ihrem Drama die Schwester zu Bertha sagen: »Oh, deine Harfe, o die tötet dich!« Ja, Annette wußte um die Gefahr, die in ihrer Maßlosigkeit lag, denn auch im Singen und Klavierspielen mutete sie ihren Kräften viel zuviel zu, und doch gab es immer wieder Nächte, in denen sie bis zum Morgengrauen spielte. Die Mauern des Saales waren dick, die Gänge lang und hoch die Treppen. Die Eltern konnten ihr Spiel nicht hören, und Jenny verriet ihre Schwester nicht; sie protestierte und mahnte zwar, weinte auch ein bißchen, aber schlief dann ein.
Annette jedoch, mit übermäßig geweiteten Augen, das Gesicht dem hohen Fenster zugekehrt, unter dem das Wasser träge an die hohen Burgmauern klatschte, den Mondschein in ihre geweiteten Pupillen saugend, ganz der Geisterstunde hinge- geben, spielte und spielte. Die schmalen Hände hatten Männerkräfte, wenn sie anschlugen; die Gesichte, die Ideen überstürzten sich, es war ein wildes Spiel, ein Ringen um Glücksgüter, die ihr unerreichbar waren: das Leben in seiner tausendfältigen Form: in Liebe, Freundschaft, Kampf um die Kunst, in Begegnungen mit der Geisterwelt; nur erleben, erleben wollte sie, wie die Brüder einmal das Dasein erleben würden.
Ihr schmaler Körper bebte unter der Macht der Töne, denen sie zu gebieten wußte; manchmal sang sie auch zu den eigenen Melodien mit ihrer tiefen, etwas rauhen Stimme, die die Menschen zu packen und zu erschrecken pflegte; sie schüttelte dann ihre Locken zurück, die kranke Brust begann zu keuchen, die Wangen glühten, aber sie spielte und spielte das Lied ihrer Sehnsucht und ihrer eisigen Einsamkeit in einem Dasein, das sie beengte, unter einem Gewirr von Menschen, die sie fesselten und ihr nichts und gar nichts geben konnten.
Oder sie sprach zu ihrer Musik Verse, die ihr leicht von den Lippen flossen; dann lächelte sie vor sich hin, denn sie wußte: Was in diesen Momenten aus ihren Gedanken floß, war gut, aber die Hände konnten die Tasten nicht lassen … jetzt schreiben? Nein, nein, weder die Noten zu den eigenen Melodien noch die Worte ihrer Verse.
Wenn das erste Grau am Himmel erschien und hier und dort ein Vogelschrei ertönte, sah sie vor Müdigkeit und Erregung keine Taste mehr. Nun würden die Knechte sich bald erheben, sie mußte die verräterischen Lichter löschen – nur noch ein wenig, ein wenig spielen, der Morgenstern glänzte ja noch am Himmel, einmal noch sich ausschütten in Tönen und in diese selige Welt der Harmonien eingehen, in der sie flog und nicht schwer an der Erde haftete, aber die Gedanken verwirrten sich ihr, die Finger griffen falsch … da taumelt sie in die Höhe, nimmt den Leuchter in die bebende Hand und geht schwankend, sich an den Mauern haltend, durch die endlosen Gänge in ihr Zimmer, wo Jenny tief und ruhig atmend schläft.
7. Kapitel
Im Februar 1819, da Annette ihren langen Brief an Sprickmann schrieb, war der Adel vom Lande nach Münster gekommen, wo das gesellschaftliche Leben endlich wieder an frühere Zeiten erinnerte. Zwar ist niemand ungeschoren durch die Kriegsjahre gekommen; die besitzenden Klassen haben viel an Vermögen und Besitz eingebüßt, aber ist es denn irgendwo im deutschen Reiche anders?
Clemens August von Droste mußte sein weitläufiges Stadtpalais, das so viel Unterhalt und Dienerschaft erforderte, verkaufen, und hat sich nun mit seiner Familie für die Wintermonate im Beverförder Hof, den er vor kurzem erworben, niedergelassen. Das Haus war auch geräumig und eine architektonische Sehenswürdigkeit Münsters aus der Wende des siebzehnten zum achtzehnten Jahrhunderts. In dem prachtvollen Tanzsaal in weißer Stukkatur und Täfelung, die nur von den tiefer getönten Marmorpilastern unterbrochen wurden, tanzte die Jugend nun wieder, zwar nicht mehr Gavotten und Menuette, wie die Barockputten über dem Kamin sie gesehen hatten, sondern den Walzer, der in Wien aufgekommen war.
Nach Jennys Bericht hat Annette nie gern getanzt, auch brachte sie kein Interesse für Kleiderfragen auf, und die üblichen Gespräche unter jungen Mädchen über Verliebtheiten und kleine gesellschaftliche Intrigen lagen ihr erst recht fern; sie fand ihre Rolle in der Geselligkeit auf einer ganz anderen Ebene. Annette sang und vermochte die Menschen zu ungehemmter Begeisterung hinzureißen.
Therese hatte längst ihr Verbot, daß Annette sich »produziere«, fallengelassen; das Talent ihrer Tochter schlug alle Bedenken nieder. Dabei war es nicht nur Annettens eigenartige Stimme, die ihre Zuhörer hinriß, es war die Beseeltheit des Vortrages und zudem der Inhalt dieser neuartigen Minne- und Volkslieder, die die Zuhörer packte und ihnen die Tränen in die Augen trieb. Oder konnte es der Abglanz einer versteckten Tragik sein, der Annet- tens Gesang ein so unbegreifliches Leuchten gab, ein Abglanz, den jedes nicht ganz verhärtete Gemüt fühlen mußte, einer Tragik, von der sich niemand Rechenschaft gab, und die Annette selber nicht hätte deuten können?
Vielleicht sah Wilhelmine von Thielemann ein wenig tiefer als andere Menschen; sie war eine erfahrene Frau, diese etwa vierzigjährige Generalin, von der Annette an Sprickmann geschrieben hatte, daß sie und die ältere Freundin »mit schweren Hindernissen zu kämpfen hatten, um zueinander zu kommen«.
Therese von Droste war gegen diese Bekanntschaft gewesen; die Generalin war eine exzentrische Frau mit einer bewegten Vergangenheit, war oft nervenkrank und sollte Halluzinationen haben und sich mit Geistern unterhalten. Wenn ein Umgang für Annette gefährlich war, dann dieser mit der Thielemann. Aber Annette, wie magisch angezogen von allem Außergewöhnlichen, hatte es doch erreicht, bei der Generalin aus und ein zu gehen. Sie pflegte sie sogar in Tagen, wenn die Nerven versagten und sie in einer andern Welt zu schweben schien.
Niemand mochte dann um die Kranke sein, erschien sie ihrer Umgebung doch wie eine Irre, aber Annette ließ sich zum Entzükken des Generals, der ihr sehr zugetan war, nicht abschrecken, hielt bei Wilhelmine aus und hatte einen wunderbar beruhigenden Einfluß auf die Freundin. In den Tagen und Wochen, da sie gesund war, lebte Annette in Wilhelminens Atmosphäre wie in der heiß ersehnten »weiten Welt«, aber nicht etwa wegen der von der Gesellschaft mit bewunderndem Flüstern häufig wiederholten Feststellung: die Generalin ist die Schwester der ersten früh verstorbenen Braut des Novalis, der unsterblich gewordenen Julie von Charpentier. Was für ein Verdienst hatte Wilhelmine daran? Sondern weil das Leben dieser Frau weit von allem Herkömmlichen verlaufen war. Und wie hatte Wilhelmine es gemeistert! Wie war sie keinem Hindernis ausgewichen; sogar den eigenen Eltern hatte sie zu widerstehen gewußt; das gab Annette viel zu denken.
Jetzt war Wilhelmine Generalin und eine reiche Frau, aber nur durch die Wechselfälle der napoleonischen Ära war ihr Mann, der in Rußland mit großer Bravour gekämpft hatte, so hoch gestiegen. Als junges Ding war Wilhelmine mit Thielemann auf und davon gegangen; ihr Geliebter war damals noch Unterleutnant gewesen.
Von den Eltern verstoßen und verflucht, hatte sie ihre überschwengliche Liebeszeit in tiefstem Elend verbracht, das erste Kind in einer Hütte, auf Stroh liegend, geboren. Aber sie war nicht zu Kreuze gekrochen, sondern hatte ihren Mann von Land zu Land begleitet, bis er, von Ehren überhäuft und reich geworden, seine Frau in Münster zu einer der ersten machen konnte.
Annette vermochte das Aufundnieder in diesem Leben kaum zu fassen und liebte Wilhelmine schon allein ihrer Vitalität, ihres Mutes und ihrer Abenteuerlichkeit wegen. Da hatte diese schöne, jetzt so verwöhnte Frau, auf Stroh gebettet, ihr erstes Kind selig in den Armen gehalten, und in Hülshoff war die Geburt des Stammhalters ein so feierlicher Akt, daß noch heute die Sage ging, der Schloßelf wandle in der großen Stunde zum Weiher und tauche mit dem ersten Schrei des Kindes in das burgbeschützende Wasser hinunter.
In Annettens Leben war alles starre Konvention, Gehorsam gegen die Überlieferung, strenge Abgeschlossenheit durch eine unüberbrückbare Kluft von der übrigen Welt; der Welt, die nicht dem Hochadel angehörte … und Wilhelmine war frei wie eine Marketenderin durch die Kriegszonen vagabundiert, bis sie im Kreise von Fürsten und berühmten Heerführern aufgenommen wurde.
Annettens Fernweh berauschte sich an den sprühenden, feurigen Worten dieser Frau, die noch so jung empfand und so beweglich war an Geist und Körper, als hätte der Himmel ihr zum Lohn für ihren Lebensmut die ewige Jugend geschenkt. Ja, sie trank beseligt von diesem Quell eines echten Lebens! Was war das Geschwätz auf Bällen und Redouten, was das romantische Säuseln im literarischen Kränzchen, was die kleinen Familien- begebenheiten, die in den Mittelpunkt der Welt gerückt wurden, gegen die Erlebnisse einer Wilhelmine von Thielemann, gegen ihre saftige Sprache, ihr sonores Lachen, mit dem sie das Entsetzen ihrer Standesgenossen hinnahm, gegen ihre handfesten Lebensregeln? Ja wahrhaftig, Schiller hatte tausendfach recht: »In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne!«
Oh, wäre sie doch gesund, dann würde auch sie vielleicht den Willen finden, der sie hinausführte, dorthin, wo sie ihre Kräfte regen durfte. Aber in diesem Frühling des Jahres 1819 weiß sie besser denn je, daß ihr Körper – »Bruder Esel«, wie Sankt Franziskus gesagt hatte – ihr für immer störrisch den Dienst verweigern würde.
Der Arzt in Münster sagte, das vegetative Nervensystem sei nicht in Ordnung, und sprach viele gelehrte Worte über den »Sympathicus«, wobei Annette fand, daß dieses Wort schlecht gewählt sei; ihr waren diese Magenkrämpfe und das Erbrechen, die Herzbeschwerden und Augenschmerzen, die Gereiztheit und die Schlaflosigkeit durchaus nicht mit dem Worte »Sympathie« in Verbindung zu bringen!
Eine Kur in Bad Driburg wurde verordnet. Therese stöhnt über die großen Ausgaben, aber die gute Großmutter in Bökendorf, die über alles auf dem laufenden ist, behauptet, selber eine Kur gebrauchen zu müssen, und nimmt, wie es Sommer gewor- den, Annette mit in den eleganten Badeort.
So trinkt Annette nun das heilende Wasser und badet; »Bruder Esel« fügt sich dem Geist und der Seele etwas williger als zuvor, aber der verhängnisvolle Kreislauf: gestählter Körper – große Aufnahmefähigkeit äußerer Eindrücke; dadurch Schwächung des Körpers und mangelnde Widerstandskraft des Geistes – ist auch in Driburg nicht zu unterbrechen.
Annette war, wie überall, gleich im Mittelpunkt der Anteilnahme ihrer Umgebung. Eine fünfunddreißigjährige Frau von Stuttnitz, »die aussieht als wäre sie sechzig, weil sie schon seit Jahren ganz kontrakt von der Gicht ist«, suchte Annettens Freundschaft. Die Kranke schien ihr nur Geist zu sein; Annette hatte »die phantastischen Briefe« lesen dürfen, die sie mit Zacharias Werner wechselte, dem sie in einer platonischen Freundschaft innig zugetan war, auch wurde sie davon unterrichtet, daß der Seelenfreund nicht nur ein großer Bühnenschriftsteller, sondern ein Mystiker und Romantiker sei, der vor kurzem in den Katholizismus geflohen war, als in die Welt des vollkommen Schönen.
Annettens gesunden Glauben mutete diese Frömmigkeit aus Ästhetizismus unbehaglich an; viel ernsthafter beschäftigte sie die Möglichkeit einer reinen Freundschaft zwischen zwei hochstehenden Menschen, die Liebe im höchsten platonischen Sinne, die Leidenschaft des Geistes von einer zärtlichen Neigung durchblutet, dieses Glück, das – sie sah es ja in ihrem Miterleben – von keiner Entfernung und keiner Krankheit zerstört werden konnte. Nein, bei all ihrer schlichten Güte wirkte die Stuttnitz in ihrem gehobenen Geistesleben nicht beruhigend auf Annettens erregbare Nerven.
Zum Glück gab es als Ausgleich unter den Badegästen Herrn von Knigge, einen Neffen des berühmten Knigge; der hatte sich mit Annette im Reiche der Musik gefunden, aber bald war nur noch von den Reisen in Afrika und Asien die Rede, die dieser unternehmungsfrohe Mann hinter sich hatte. Annette veranlaßte ihn, immer mehr und immer Neues von seinen Abenteuern unter den Menschen in den fremden Erdteilen zu erzählen.
Und eine Nichte des Herzogs von Hamilton, dreiunddreißig Jahre alt, verheiratet, aber kinderlos, die Annette »meine liebe Mine« nennt, wurde ihr lieb und vertraut. Von ihr schreibt Annette an die Mutter:
»Sie ist sehr groß und schlank; Zug für Zug sehr schön, und doch kömmt sie einem im ganzen eher häßlich vor; ich glaube, weil sie zu viel wie ein Mann aussieht. Ich glaube auch, daß sie noch mehr Verstand hat wie ihr Mann. Sie hält äußerst auf ihr point d’honneur und ein edles anständiges Betragen. Ich glaube, du würdest sie sehr lieb gewinnen, nur ist ihre Gegenwart trotz aller Freundlichkeit etwas drückend; sie hat mich außerordent- lich lieb und, seit sie fort ist, schon sechsmal geschrieben, ich habe aber erst einmal antworten können.«

