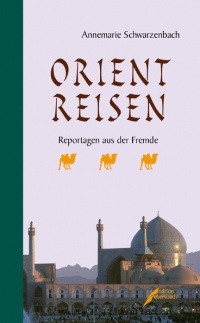«Die Frauen Afghanistans»
Von Annemarie Schwarzenbach
«Unser Leben gleicht der Reise …
und so scheint mir die Reise weniger
ein Abenteuer und Ausflug in ungewöhnliche Bereiche zu sein, als vielmehr ein konzentriertes Abbild unserer Existenz». A.S.
Teil II, Orient Reisen
Ella und ich hatten bisher nur theoretische Gespräche über die Frauen Afghanistans führen können. Seit mehreren Wochen in diesem streng mohammedanischen Land, hatten wir uns mit Bauern und städtischen Beamten, Soldaten, Bazarhändlern und Provinzgouverneuren angefreundet, waren überall gastfreundlich aufgenommen worden und begannen dieses männliche, fröhliche und unverdorbene Volk liebzugewinnen. In der prächtigen alten Stadt Herat hatten wir den Fechterspielen und dem gemeinsamen Gebet der Jünglinge zugesehen, die sich abends vor dem Tor auf einem Rasenplatz versammelten. Unterwegs auf langen schattenlosen Strecken, wenn wir Halt machten, gesellten sich schlichte Bauern zu uns und teilten mit uns ihre Melonen. Nie hatten wir es nötig, unser Zelt aufzuschlagen und unsere Suppe selber zu kochen. Wir wurden in den Dörfern vom Bürgermeister begrüsst, mit Tee und Trauben bewirtet. Am Abend führte man uns in schöne Gärten: aufmerksame Diener trugen den »Palaw«, das einheimische Reisgericht, auf, und während wir assen, kam der Gastgeber mit seinem Gefolge, um uns seinen Besuch zu machen, und unterhielt sich oft lange und eingehend mit uns.
Aber wir schienen in einem Land ohne Frauen zu sein!
Wir kannten wohl den Tschador«, das alles verhüllende Faltengewand der Mohammedane-rinnen, das mit den romantischen Vorstellungen vom zarten Schleier orientalischer Prinzessinnen wenig gemeinsam hat. Er umschliesst eng den Kopf und ist vor dem Gesicht wie ein Gitterchen durchbrochen und fällt dann in weiten Falten bis zur Erde, kaum die gestickte Spitze und den schiefgetretenen Absatz der Pantoffeln frei lassend. Wir hatten solche vermummten, formlosen Gestalten scheu durch die Bazargassen huschen sehen und wussten, das seien die Frauen der stolzen, frei einherschreitenden Afghanen, die ihrerseits die Gesellschaft und das fröhliche Gespräch liebten und den halben Tag nichtstuend im Teehaus und im Bazar verbrachten.
Aber diese gespenstischen Erscheinungen hatten wenig Menschliches an sich. Waren es Mädchen, Mütter, Greisinnen; waren sie jung oder alt, froh oder traurig, schön oder hässlich? Wie lebten sie; mit was beschäftigen sie sich; wem galt ihre Anteilnahme, ihre Liebe oder ihr Hass?
In der Türkei, auch in Iran hatten wir Schülerinnen, Pfadfinderinnen, Studentinnen gesehen, auch selbständige, erwerbstätige Frauen oder solche, die auf sozialem Gebiet etwas leisteten und bereits das Gesicht ihrer Nation mit bestimmten, aus dem Leben dieser Nation nicht mehr hinwegzudenken waren. Wir wussten, dass der junge König Amanullah, von einer europäischen Reise zurückkehrend, in Afghanistan überstürzte Reformen eingeführt und versucht hatte, dem Beispiel vor allem der Türkei zu folgen.
Er war zu rasch vorgegangen. Am meisten warf man ihm die Emanzipation der Frau vor. Während einiger Wochen war in der Hauptstadt Kabul der Tschador gefallen; dann brach die Revolution aus; die Frauen kehrten in den Harem, in ihr streng abgeschlossenes häusliches Leben zurück und durften sich auf der Strasse nur noch im Schleier zeigen.
Waren die Ansätze zur Freiheit vergessen, die wenigen Wochen des Jahres 1929 aus dem Gedächtnis der Frauen verschwunden?
Als wir einmal Gäste eines jungen, aufgeschlossenen und klugen Gouverneurs irgendwo im Norden waren, wagte Ella die Frage. Unser Gastgeber hatte viel Verständnis für die Notwendigkeiten des afghanischen Staates gezeigt und hatte davon gesprochen, wie der Bau von Strassen das Land dem Verkehr öffnen werde, wie dann Industrien eingeführt, aber auch Schulen und Spitäler eingerichtet würden. Konnte man die Frauen von solch einem Programm des Fortschritts ausschliessen? Mussten sie nicht teilnehmen am neuen Leben und befreit werden aus der abstumpfenden Beschränktheit ihres Daseins? Der Gouverneur antwortete ausweichend. Als wir höflich fragten, ob wir seine Frau besuchen dürften, sagte er zwar zu, fand dann aber eine Ausrede.
Erst in Kaisar, einem kleinen Oasenort in der nördlichen Provinz Turkestan, wurden wir zu unserer nicht geringen Überraschung von »Hakim Saib«, dem Herrn Bürgermeister selbst, ohne viel Umstände durch ein Pförtchen in den inneren Garten seines Hauses geführt, dem Garten seiner Frau und Töchter. Zwei junge Mädchen in Sommerkleidern, das dunkle Haar von luftigen, zarten Schleiern eingehüllt, kamen uns lächelnd entgegen. Sie waren beide auffallend schön, und schön war auch die stattliche, ernst und freundlich blickende Mutter, die uns unter den grossen Bäumen begrüsste, wo Teppiche ausgebreitet waren. Dort spielten auch die Kinder, jüngere Geschwister, und das blonde Bübchen der Schwiegertochter Sarah.
Ihr zweites Kind schlief in einer Hängematte im Schatten.
Ein wenig abseits, unter dem Vordach des einfachen Lehmhauses, stand der Samowar; man brachte uns zuerst ein Waschbecken und Handtücher, dann Tee und Früchte.
Eine Stunde später folgte der Palaw. Die Mutter ass mit uns nach europäischer Manier am Tisch. Die Töchter bedienten uns und assen dann mit den Kindern auf dem Teppich, alle aus der gleichen riesigen Reisschüssel – und mit den Fingern. Zuletzt assen die Dienerinnen die reichlichen Reste. Während die Familie des Hakim die schönen und strengen Gesichtszüge der Afghanen hatte, waren die Dienerinnen offenbar mongolischer Rasse, vielleicht Turkmeninnen oder Usbekinnen.
Nach dem Essen brachte man uns seidene Matratzen und Moskitonetze; aber wir kamen nicht dazu, uns auszuruhen. Obwohl die Mädchen kaum ein Wort französisch kannten und wir nur ein paar Brocken persisch, unterhielten wir uns doch ganz lebhaft. Sie brachten uns einen hellblauen Seidenstoff und eine Schere und wollten, dass wir ihnen ein Kleid zuschnitten. Wir wagten uns aber nicht daran und versprachen, ihnen von Kabul französische Zeitschriften mit Schnittmustern und Modebeilagen zu schicken. Kabul war für die Frauen von Kaisar schon die grosse Welt, die Zivilisation.
Und doch waren sie – zuhause natürlich – im Lesen und Schreiben unterrichtet worden und wussten, wo Indien, Moskau, Paris lag, ja sogar die Schweiz war ihnen ein Begriff. Aber sie hatten nie eine Reise gemacht. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie jemals weiter gelangen würden als bis nach Mazar-i-Sherif, der Hauptstadt von Afghanisch-Turkestan.
Hatten sie überhaupt den Wunsch, die Welt kennenzulernen, ein anderes Leben zu führen? Oder würden sie immer im schattigen von hohen Lehmmauern umschlossenen Garten von Kaisar bleiben, unter der patriarchalisch strengen Aufsicht ihrer Mutter und Herrin?
Gegen Abend, als es ein wenig kühler wurde, liess uns der Hakim rufen. Der kleine blonde Yakub durfte uns bis zum Auto begleiten; die Mädchen aber blieben an der Gartenpforte zurück.
Es waren zweifellos kluge, ja begabte und anmutige Mädchen. Wir erinnerten uns an ihr Lächeln, an ihren wachen und freundlichen Gesichtsausdruck. Nur die junge Schwiegertochter hatte manchmal herb und fast böse dreingesehen, während sie ihren Säugling aus der Hängematte nahm und ihm die Brust gab. Sie war hier, in der Familie ihres Gatten eben doch unter Fremden, hatte keinen eigenen Haushalt und hatte keinerlei Freiheit und Rechte.
Wenn diese Mädchen den Garten verliessen, trugen sie den Tschador – und sahen die Welt draussen nur durch das durchbrochene Gitterchen, das ihr Gesicht neugierigen Männeraugen verbarg.
Ein solches Leben konnten wir uns kaum vorstellen.
Aber waren diese Frauen etwa besonders unglücklich?
– Man kann nur begehren, was man kennt. Und war es richtig, nötig, sie zu bilden und aufzuklären, und ihnen den Stachel der Unzufriedenheit zu geben? – Aber wir lernten bald, dass diese Frage sich gar nicht stellt.
Afghanistan entwickelt sich heute nach jenen fatalen Gesetzen, die man Fortschritt nennt und deren Verlauf man nicht aufhalten kann. Als wir von Kabul aus die versprochenen Schnittmuster nach Kaisar schickten, leisteten wir auch einen winzigen Beitrag zu den Folgen dieser Gesetze. Wir bekämpften den Tschador!
Walter Fähnders
Annemarie Schwarzenbachs Orientreisen
Nachwort
1.
Annemarie Schwarzenbach (1908 – 1942) war gerade 24 Jahre alt, als sie ihre erste Orientreise plante. 1931 hatte sie mit Bravour ihre Doktorprüfung an der Universität Zürich bestanden, gleichzeitig war ihre erste größere Literarische Arbeit, der Roman Freunde um Bernhard, erschienen.
Anschließend siedelte sie nach Berlin über, nicht zuletzt, um von den massiven familiären Konflikten, denen sie wegen ihres selbständigen Lebenswandels zeitlebens ausgesetzt war, zumindest räumlichen Abstand zu gewinnen.
Zusammen mit Erika und Klaus Mann, die sie seit ihrer Zürcher Studienzeit kannte, und dem Maler und Illustrator Ricki Hallgarten, einem Jugendfreund der Geschwister Mann, nahm sie sich für das Frühjahr 1932 eine Orientreise vor – eine Reise bis nach Persien (wie der Iran sich bis 1934 nannte). Darüber, dass diese Fahrt nicht zustande kam, berichtete sie am Pfingstsonntag 1932 an ihren vertrauten akademischen Lehrer und Mentor Carl Jakob Burckhardt:
»Die Expedition war eigentlich in jeder Hinsicht gut vorbereitet, wir wollten durch Klein Asien bis Persien u. durch Russland zurückfahren, u. hatten zu diesem Zweck zwei sehr gute neue Fordwagen gestellt bekommen. Wir waren zu viert. Am Tag vor dem Start hat sich unser Freund Ricki Hallgarten, der vierte Teilnehmer, erschossen.
Ich habe den Tod noch nie so aus der Nähe erlebt, u. ich hatte mir auch nie klargemacht, dass ein solches Ereignis eine sofortige Gewalt über uns ausüben könne – innerlich wie äusserlich. Wir haben die Reise aufgegeben u. wollen morgen für einige Zeit nach Venedig fahren. «Aber dies war nur ein Aufschub – insgesamt viermal sollte Annemarie Schwarzenbach in denOrient reisen, und dies jeweils für mehrere Monate.
Zur ersten Orientreise brach sie bereits 1933 auf, nachdem sie, die Wahlberlinerin, am 30. Januar die Machtübergabean Hitler miterlebt hatte.
Durch Fachlektüre und den Besuch einschlägiger Berliner Museen vorbereitet, reiste sie vom Oktober 1933 bis April 1934, nun ohne die Geschwister Mann, in den Nahen Osten. Die Route verlief über die Türkei, Syrien, Libanon, Palästina, Irak bis nach Persien, von wo aus sie über Baku nach Europa zurückkehrte.
Ihre zweite Orientreise führte sie 1934 erneut nach Persien und erfolgte im Anschluss an ihren Moskau-Besuch vom August desselben Jahres. In Moskau hatte Annemarie Schwarzenbach zusammen mit Klaus Mann am sowjetischen Schriftstellerkongress teilgenommen, alleine reiste sie für drei Monate weiter nach Teheran. Von April bis Oktober 1935 reiste sie erneut nach Persien. Anlass war ihre Eheschließung mit dem Diplomaten Claude Clarac, der als Zweiter Sekretär in der französischen Gesandtschaft in Teheran tätig war und mit dem sie sich bereits während ihrer zweiten Persienreise verlobt hatte. Im Oktober kehrte sie in die Schweiz zurück, die folgenden Jahre lebte sie in Europa und den USA.
Ihre letzte und spektakulärste Orientreise unternahm Schwarzenbach zusammen mit der damals schon renommierten Schweizer Reiseschriftstellerin Ella Maillart. In einem nagelneuen 18 PS-starken Ford Roadster starteten die beiden Frauen am 6. Juni 1939 von Genf aus und erreichten Ende August Kabul. Die Reisenden trennten sich später in Afghanistan. Ella Maillart war enttäuscht von ihrer Reisepartnerin, die den Drogenkonsum nicht lassen konnte.
Annemarie Schwarzenbach verließ das Land Ende 1939, nicht zuletzt unter dem Eindruck des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Denn jetzt seien, schrieb sie, »die Zeiten friedlich-abseitigen Lebens […] vorbei. Ich möchte in die Schweiz zurückkommen, nicht, um mich zu vergraben, sondern um teilzunehmen an dem, was unser Leben ist.«
Über Indien, Aden und durch den Suez-Kanal fuhr sie zurück nach Europa, um alsbald in die USA und zuletzt nach Afrika und Portugal zu reisen. Den Orient hat sie (abgesehen von einem kurzen Aufenthalt in Marokko) in den wenigen Jahren bis zu ihrem frühen Tod 1942 nicht mehr besucht.
2.
Annemarie Schwarzenbach gehört einer Generation an, für die das Reisen längst etwas Selbstverständliches war, jedenfalls in jenen privilegierten Kreisen, zu denen sie zählte. »Jene Gesellschaft, die man die bürgerliche nennt«, registrierte 1927 hellsichtig der Soziologe Siegfried Kracauer, »frönt heute der Lust am Reisen und Tanzen mit einer Hingabe, wie keine frühere Epoche.«
Für Schwarzenbach und ihre Generationsgefährten wie Erika und Klaus Mann oder Ruth Landshoff-Yorck bedeutete Reisen, das anhaltende Unterwegssein eine völlig normale Existenzweise.
Klaus Mann schrieb von den »Zwangsideen unserer Generation: immer fort zu müssen«, und selbst Annemarie Schwarzenbachs Romanfiguren haben nichts anderes zu tun als »von Reisen« zu schwärmen, »von endlos weiten Reisen«, so bereits in ihrem schon erwähnten Debütroman Freunde um Bernhard. Insofern ist man, um erneut Kracauer zu zitieren, »heimisch sowohl zuhause wie anderwärts oder auch nirgends zuhause«, und weiter: »Woher es denn rührt, daß […] die Reise à la mode nicht eigentlich mehr dazu dient, die Sensation fremder Räume zu genießen – ein Hotel gleicht dem andern und die Natur dahinter ist den Lesern der illustrierten Zeitschriften bekannt – sondern um ihrer selbst willen unternommen wird«.
Dies gilt gewiss für die mobilen Existenzen der Bohème, die sich zwischen Venedig und Cannes, Paris und St. Moritz bewegten – im dortigen Palace-Hotel lernten sich übrigens Ruth Landshoff-Yorck und Annemarie Schwarzenbach kennen. Reiseziele schienen beliebig abrufbar, in der Lyrischen Novelle (1933) lässt Annemarie Schwarzenbach eine ihrer Figuren sagen: »Jetzt stellte ich mir vor, dass ich mit Sybille reisen könnte, und vor mir erstanden Hafenstädte, breite Flüsse mit schaukelnd getriebenen Booten, Steppen, wandernden Tierherden, Flugplätze mit frischen Holzbaracken, Lastautomobile auf weißen Strassen und glühende Sonne über gedeckten Veranden. ›Am besten würden wir dann gar nicht mehr zurückkommen‹, sagte ich.
Mit derartigen Imaginationen ist angedeutet, dass es Schwarzenbach dann doch nicht oder nicht mehr um die geradezu ›normal‹ gewordene, snobistische Mobilität der Bohème ging, die sie in ihrem das globalisierte Reisen vorwegnehmenden Artikel »Plaza Hotel« kritisiert und der hier auch deshalb den Reigen der abgedruckten Orienttexte eröffnet. Noch in einem wenige Monate vor ihrem Tod in der Basler National-Zeitung erschienenen Artikelüber Marokko setzte sie sich von jener Spezies von »Weltenbummler« ab, die es verstünden, »ein Land mühelos mit dem nächsten zu vertauschen, römische Ruinen mit griechischen, die Sphinx mit mexikanischen Pyramiden, die persischen Totentürme mit nordischen Heldengräbern und den Tag im Osten mit der Nacht im Westen. Diese Touristen pflegten leicht die Meinung zu verbreiten, die Welt sei am Ende ein nicht allzu grosser Tummelplatz und in langweilige und weniger langweilige Länder eingeteilt, nach Massgabe des Reizvollen, Neuen und Seltenen, das sie zu bieten hätten, und ohne dass doch der Unterschied zwischen den Kulis in Siam und denen auf Jamaika schliesslich nennenswert sei.«
Eben weil der Unterschied zwischen den Kulis in Siam auf Jamaika durchaus »nennenswert« scheint, sucht Annemarie Schwarzenbach eine Philosophie – und Poetik – des Reisens zu entwerfen, die dem globalisierten Reisen widersteht und widerspricht, die auf Differenz achtet und dabei das Reisen selbst zu einer Kategorie des Existenziellen erhebt.
Dies ist ein Prozess, der sich seit ihren großen Reisen in den Osten beobachten lässt, wobei sie nicht müde wird, das so verstandene Reisen als Arbeit, als Herausforderung zu beschreiben. In »Die Steppe«, einem Schlüsseltext für ihre orientalischen Erfahrungen ›on the road‹, schreibt sie:
»Die Reise aber, die vielen als ein leichter Traum, als ein verlockendes Spiel, als die Befreiung vom Alltag, als Freiheit schlechthin erscheinen mag, ist in Wirklichkeit gnadenlos, eine Schule, dazu geeignet, uns an den unvermeidlichen Ablauf zu gewöhnen, an Begegnen und Verlieren, hart auf hart.«
Reisen wird zum Synonym für die menschliche Existenz überhaupt: »›Unser Leben gleicht der Reise …‹, und so scheint mir die Reise weniger ein Abenteuer und Ausflug in ungewöhnliche Bereiche zu sein, als vielmehr ein konzentriertes Abbild unserer Existenz.« Schwarzenbach zitiert hier aus dem in der Schweiz berühmten »Beresina-Lied«, das den Untergang der in Napoleons Diensten stehenden Schweizer Truppen 1812 zum Thema macht, lädt den Text also durch seinen Bezug auf eine geschichtliche Katastrophe zusätzlich mit Bedeutung auf.
›Reisen‹ und mit ihm ›Schreiben‹ wird zu einer Grundform menschlichen Daseins überhaupt aufgewertet. Annemarie Schwarzenbach outet sich selbst als manische Schreiberin – »Wirklich, ich lebe nur wenn ich schreibe«, notiert sie am 30.8.1939 in ihrem Kabuler Tagebuch.9 In einem unveröffentlicht gebliebenen Afghanistan-Artikel thematisiert sie genauer die Nähe von Schreiben und Reisen:
»Heute über ein fernes, asiatisches Land zu schreiben, bedeutet für mich immer eine Versuchung, – die Versuchung, mich selbst innerlich weit weg zu begeben von der Welt der uns täglich umgebenden Tatsachen und Probleme, – genau wie ich beim Antritt einer grossen Reise von allen Gewohnheiten des Alltags Abschied nahm, und glaubte, ich würde jenseits einer mir noch unbekannten Grenze auf meinem Wege ein ganz anderes, ganz neues Leben finden, ein Leben ohne Traditionen, Konventionen und Gesetze, – eine Form der Freiheit, eine absolute Form.
Und dieser Wunsch, die Sehnsucht nach dem Absoluten, ist ja wohl der eigentliche Antrieb jedes echten Reisenden. Vermutlich bin ich ein solcher unheilbarer Reisender.«
In dieser Selbsteinschätzung ist ein hoher Anspruch an das Reisen wie an das Schreiben formuliert, der mit den äußeren auch innere Grenzüberschreitungen einrechnet und programmatisch auch als notwendig erachtet.
Das Plaza-Hotel-Reisen ist verabschiedet, das Reisen erhält seine ursprüngliche Funktion zurück, in Ungewisses zu führen, aber auch seine utopische Bedeutung, nämlich der Ichfindung durch die Erfahrung des Fremden, des und der Anderen. Die Topographie des Reisens fällt mit der des Schreibens zusammen, für beides ließe sich anführen, was Annemarie Schwarzenbach in Tod in Persien für den Orient, für die Fremde überhaupt notiert: »hier gelten unsere
Massstäbe und Erklärungen nicht mehr«.
3.
Auch wenn Annemarie Schwarzenbach für sich des Öfteren in Anspruch nahm, »das gewohnte Leben willkürlich an einer Stelle abzubrechen, ohne dafür einen vernünftigen Grund anzugeben«, so verweisen ihre ausgedehnten Reisen gerade in den Orient und die umfangreiche Reise- und Reportageliteratur, die sie nun verfassen wird, auf eine markante biographische Konstellation. Nach der geplatzten Reise von 1932 jedenfalls realisierte sie energisch ihr Vorhaben.
Dabei spielte der Versuch, nach den Berliner Jahren eine festere Lebens- und Arbeits- perspektive zu gewinnen, ebenso eine Rolle wie die Verstörung über das, was seit 1933 politisch über »Europa wie eine Welle der Finsternis, bestürzend und ungewiss«, hereinbrach, wie sie aus Bagdad an Klaus Mann schrieb.
Dies führte sie in die Fremde, hinzu kam ausgeprägte archäologische Neugier. Auf allen ihren Orientreisen, sowohl im Nahen Osten als auch in Persien und zuletzt in Afghanistan, beteiligte sie sich an Ausgrabungen amerikanischer bzw. französischer Archäologen.
Man wird Annemarie Schwarzenbach deshalb nicht zur großen Archäologin stilisieren, aber für die Historikerin, die über die Frühe Neuzeit promoviert hatte, war dies doch eine Arbeit, die, wie sie ihrem nahen Freund Claude Bourdet schrieb, »concret« und »objectif« schien – handfest auch gegenüber der bisherigen literarischen Tätigkeit.
Auch ihre zahlreichen Fotografi en belegen dieses archäologische Interesse. »Wer einmal ›draußen‹ war«, schrieb sie 1935 in der Zürcher Illustrierten, »wird trotz Entbehrung und Einsamkeit immer wieder in den Bereich der Ausgräber zurückkehren.«
Mit ihrem Romandebüt Freunde um Bernhard von 1931 hatte Annemarie Schwarzenbach lediglich einen Achtungserfolg erzielt, ihr zweiter Roman, die Lyrische Novelle, Anfang 1933 bei Rowohlt erschienen, ging im Strudel der NS-Machtübernahme unter. Aber dabei blieb es auch – zahlreiche Erzählungen dieser Jahre blieben ebenso ungedruckt wie zwei weitere Romane (Flucht nach oben, postum erst 1999 erschienen, und Aufbruch im Herbst, verschollen) sowie ihr Drama Cromwell. Als Autorin hatte sie sich zu dieser Zeit weder in der Schweiz noch in Deutschland durchsetzen können, und nach 1933 gab es für sie in Deutschland keinerlei Publikationsmöglichkeiten mehr.
Den NS-Behörden war zwar bekannt, dass die Schweizer Familie Schwarzenbach mehrheitlich mit den Nationalsozialisten sympathisierte, aber es war ebenso aktenkundig, dass Annemarie Schwarzenbach Kontakt zum antifaschistischen Exil hielt, so zum Kreis um Klaus Manns Zeitschrift Die Sammlung.
Die mit den Orientreisen beginnende neue Schreibphase stieß in der Öffentlichkeit rasch auf Resonanz, Annemarie Schwarzenbach reüssierte als Journalistin und Reporterin und wurde auch als Berichterstatterin in Sachen Archäologie wahrgenommen. So brachte die Zürcher Illustrierte 1935 ihren groß aufgemachten Bildbericht über eine archäologische
Grabungsstelle im Iran.16 Einen dezidiert politischen Akzent dabei setzte Annemarie Schwarzenbach selbst, als sie über ihre Ausgrabungen in der Nähe Teherans schrieb, sie würde »hauptsächlich Schädel messen u. die Absurdität der deutschen Rassen-Idioten an iranischen Beispielen kund tun, das allein kommt mir verführerisch vor.«
Wenn das dritte Buch, das Annemarie Schwarzenbach veröffentlichen konnte, Winter in Vorderasien von 1934, ein Reisebuch war, so hing dies eben mit der ausgedehnten Reise tätigkeit zusammen, und es war die Reisepublizistik, die sie als Autorin zumindest in der Schweiz bekannt machte, sie wurde als Verfasserin von Reportagen, Reise und Bildberichten aus dem Orient, aber auch aus Europa, den USA und zuletzt aus Afrika und Portugal zunehmend geschätzt (und übrigens auch dementsprechend hoch honoriert).
Die Bibliographie weist für das Jahr 1934 rund drei Dutzend veröffentlichte Reportagen und Reiseberichte aus, für 1940 bereits über 50.
Dabei spielen die ›orientalischen Texte‹ eine zentrale Rolle: Rund ein Drittel aller Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, die sie überhaupt publiziert hat, sind dem Orient gewidmet, das sind gut 100 Texte, Bildreportagen eingerechnet (sie sind längst nicht alle ediert bzw. nachgedruckt).
Hinzu kommen die beiden Orientbücher Winter in Vorderasien (1934) und Das Glückliche Tal (1940) sowie die zu ihren Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen Buchmanuskripte Der Falkenkäfig (1934/35), Tod in Persien (1935) und Die vierzig Säulen der Erinnerung (1939/40). Über keine der von ihr bereisten Weltgegenden oder «Welt-Landschaften» hat sie derart häufig und umfangreich, auch so vielfältig und intensiv geschrieben wie über den Orient.
[1940]
«Orientreisen»
Reportagen aus der Fremde. Edition Ebersbach, Berlin 2010
Herausgegeben von Walter Fähnders, 192 Seiten, Abb., gebunden, CHF 34.80. ISBN 978-3-86915-019-2