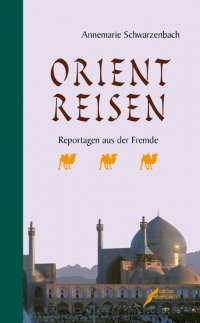© edition ebersbach Annemarie Schwarzenbach in Anatolien, 1933
«Plaza Hotel»
Von Annemarie Schwarzenbach
Es ist sicher gleichgültig, ob dieses »Plaza« sich gerade in New York oder in Bombay oder Kalkutta befindet, in Tokio, auf den Bahamas – sicher wohnen dort, auf den Bahamas, heute schon viele Leute, die reich sind und sich deswegen weder als «Emigranten» noch als »Refugees« zu bezeichnen brauchen, und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Plazas und Ritz’ und Palace-Hotels in der ganzen Welt sich gleichen: ihre Badezimmer haben die gleichen Ausmaße, der in ihren Bars eisgekühlte «Dry Martini» schmeckt gleich, auch die Preise, in Singapore und in Barcelona, oder auf dem Ozeandampfer, sind mindestens vergleichbar, – höchstens daß die Kellner und die Stewards in Suez die Jacken wechseln, denn gerade dort, am Ausgang des Suez-Kanals, erkältet man sich leicht, und es wird auch den Gästen anempfohlen, ihre weißen Dinner-Jackets aus Indien mit den schwarzen, in Europa üblichen Smokings zu vertauschen.
Ich kenne Weltreisende, die in New York ihr Billet bestellt und gleich erklärt haben, sie hätten nicht mehr als drei Sommermonate Zeit, und die dann also in ihrer weißlackierten Kabine in knapp drei Monaten die Erde umsegelten, schneller als Jules Verne. Ich habe das Buch von Jean Cocteau gelesen, der auch den Rekord überbot und keine neunzig Tage brauchte, um in den Häfen von Indie n, China und Australien mit gelben, schwarzen und vor allem französischen Matrosen seine Opiumpfeife zu kosten und sich überdies in Japan von der französischen Botschaft zum Diner einladen, in Hawaii von schönen, eingeborenen Mädchen mit Seerosen bekränzen zu lassen. Ich erinnere mich ferner genau, wie ich nach einer langen Wüstenfahrt nach Jerusalem kam, dort im Hotel »King David Tower« zuerst einen Cocktail trank, dann ein Plakat sah mit der Ankündigung, dass der Geiger jüdischer Abstammung, der noch vor drei Jahren ein Publikum in Berlin in Entzücken versetzt hatte, als er das Brahms-Violinkonzert mit Furtwängler als Dirigenten spielte, – am gleichen Abend in der Zions halle von Jerusalem das gleiche Konzert spielen würde. Im gleichen Hotel – ebenso gut hätte es »Jerusalem Plaza« sein können – traf ich fünf junge Mädchen und ihre beiden ältlichen Lehrerinnen aus einem Bostoner Mädchenpensionat. Sie waren 18 bis 20 Jahre alt, noch nicht verlobt, hatten Sommerferien, und sollten die Welt kennen lernen. Sie hatten den Hafen von New York, die Freiheitsstatue, den Felsen von Gibraltar, Marseille, Genua, den Vesuv, Capri und die Kanonen von Malta gesehen, hatten zum Frühstück kalifornischen, spanischen, dann Orangensaft aus Jaffa getrunken, hatten die Moscheen von Damaskus, die Ruinen von Baalbek, einen Kamelrücken und den See Genezareth gesehen und würden noch Indien sehen, das »Plaza« von Bombay, die Nächte und Kirschblüten von Japan. – Ich weiß jetzt auch wieder, warum ich mich an die belanglosen amerikanischen Pensionsschülerinnen genau so deutlich erinnere wie an das Konzert von Hubermann, das doch damals, als ich noch taumelte vom Schwindel weißer Nebel aus Hitze, von Entbehrungen und menschenleeren Weiten, über mich hereinbrach mit den vollen Klänge menschlicher Trauer, bewegter Süße. Die Mädchen im David-Tower-Hotel hingegen waren bestimmt belanglos, sind ohne Zwischenfall nach New York zurückgekehrt, haben sich ihre Abendkleider für die nächste Saison bestellt und sind jetzt glücklich verheiratet, mit wenig Erinnerungen, aber mit Sommerhäusern in Florida, in Palm Beach, Kalifornien, und Jachten.
Aber ich traf damals, in Jerusalem, nicht allein ein, sondern mit meinem jungen Freund Paul, einem Studenten der Anthropologie der Universität Chicago, der eines jener Mädchen kannte, mit ihr auf Jugendbällen getanzt hatte und sich beinah als ihr Verlobter betrachtete. Seit zwei Jahren saß Paul auf einem Ausgrabungshügel in Syrien; er war «hängen» geblieben, hatte eine prähistorische Höhle ausgegraben, kochen gelernt und sehr viel Whisky getrunken.
Da kam das Telegramm aus dem »Plaza« in Damaskus, – er machte sich sofort auf, bat den Direktor, ihm ein paar Tage Urlaub zu geben, und mich, ihn auf der Wüstenfahrt nach Jerusalem zu begleiten. Während ich dann in der Zionshalle das Brahms-Konzert hörte, aß Paul mit seiner Jugendfreundin zu Abend. Als ich, nach dem Konzert, zu ihnen stieß, hatte Paul gerade eine Flasche auf dem Berge Karmel gereiften Rotweins bestellt und sie wärmen lassen wie einen Burgunder. Und Paul erzählte, – ich wusste schon, wie er erzählen konnte, aus einem Foxtrott machte er einen ekstatischen Indianertanz, aus einer Regennacht eine von Tropenstille erhellte Mondnacht und aus einem Schluck Whisky eine Orgie. Amerikanische Landstraßen in Georgia, seiner Heimat, wurden, wenn er so erzählte, die letzten Landstraßen der Welt, – und einer herrlichen, trunkenen, in Myriaden von Begeisterungen wie in Milchstraßen gebadeten Welt. Mein Freund Paul! –
Das Mädchen, Jean, schien mir auffallend hübsch. Sie trug ein leichtes, helles Sommerkleid und einen Blaufuchspelz um die Schultern. Als sie am nächsten Morgen im extravaganten Autobus abfuhr, kauften Paul und ich ihr in aller Eile ein echtes Silberarmband, schön ziseliert wie eine Damaszener Klinge, und mit Türkisen besetzt. Aber ich greife vor. Zusammen mit dem gewärmten Rotwein vom Berge Karmel erschien nämlich im verlassenen Esssaal des Hotels, gegen Mitternacht, eine der Pensionatslehrerinnen, um Jean in ihr eisgekühltes Schlafzimmer zu begleiten. Paul beeilte sich, er stammelte. «Wir haben, auf der Ausgrabung, einen ägyptischen Koch», sagte er, der kann auch Irish Stew machen, jeden Morgen gibt es Bier und Tomatensaft, am Abend bringt der taubstumme Diener Fichtenholz aus dem Libanon für das Kaminfeuer, wir trinken Raki, am Sonntag Whisky, damit man weiß, daß Sonntag ist, und dreimal habe ich schon die Federn des Sofas durchgebrochen – Du weißt schon, wenn ich den Indianertanz tanze, springe ich auf alle Möbel – und das Grammophon geht auch, und junge Hunde haben wir, zwei Wochen alt». Jean hörte aufmerksam zu. «Es klingt herrlich», sagte sie, «dieses Wüstenleben in Syrien». Paul bat: «Es ist kein Wüstenleben, – wir haben grünen Rasen gesät im Hof, und meine Schädel solltest du sehen, und abends den Blick über die Ebene. Ach, ich bin glücklich, daß Du gekommen bist! – Du wirst doch wiederkommen, jetzt, nachdem Du alles weißt?»
Jean verließ den Saal, und Paul und ich blieben noch lange sitzen und tranken den Rotwein, den der arabische Kellner beinahe in einen Glühwein verwandelt hatte. Dann, am nächsten Tage, kauften wir das Damaszener Armband und fuhren sicher 20 Stunden durch die uferlose Wüste, um auf unsere Ausgrabung zurückzugelangen.
Vielleicht sitzt Paul jetzt noch dort, zwischen seinen Schädelhügeln, vielleicht mit den gleichen Whiskyflaschen, den gleichen alten Khakihosen und ungeschorenen Haaren irgendwo in Afrika. Geheiratet hat er jedenfalls nicht – und jedenfalls hat das Mädchen Jean nach ihrer Weltreise geheiratet.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich jetzt, nach mehreren Jahren, plötzlich an Syrien und Jerusalem erinnere. Es ist Juli 1940, Hitze in New York, ich wohne im Plaza Hotel, warte täglich dreimal auf die Zeitungen aus Europa. Ich muß darüber nachdenken, ob man als junger, zufällig hierher verschlagener Europäer in Amerika leben könnte. In einem fortschrittlichen, reichen Land, mit Städten, Flugzeugverbindungen, Universitäten, einem Land, das vielleicht die einzige große Demokratie der Welt sein wird, einem Land jenseits des Ozeans, das aber ein riesiger, sozusagen autarker Kontinent ist – warum sollte man hier nicht leben können? Habe ich nicht, auf vielen Reisen nach Osten und Westen, gelernt, daß der Mensch beinahe überall leben kann, daß er für dieses bißchen Leben wenig braucht, und viel, nämlich das bißchen nicht zu benennender Hoffnung, eine Art von himmlischer Speise? – Oder sollte es daran liegen, daß ich nur deutsch zu schreiben verstehe, auf englisch aber eitel und geläufig daherrede, die Fremdsprache mißbrauche und mich einsam fühle, – aber ist es vielmehr, weil mich dieses Plaza Hotel an das Palace, das Palace an ein anderes Ritz erinnert, – diese großartige Stadt New York an alle wachsenden Großstädte (ja, mindestens die Vororte von New York, Chicago, Bombay und Birmingham haben eine fatale Ähnlichkeit!), – weil ich den tiefen Straßenschächten und zwischen den die Augen automatisch anziehenden Verkehrslichtern, inmitten dieser in ihrer Art perfekten organisatorischen Ordnung, nur noch ein perfekt organisiertes und reagierendes Lebewesen bin – und dieser Fähigkeiten müde?
Eines Abends verließ ich das Plaza, zunächst, um meinen Hund ein wenig spazieren zu führen, und dann, um einen wichtigen Besuch und nachher einige Besorgungen zu machen. Zwischen dem Eingang des Plaza und der berühmten «Fifth Avenue» befindet sich ein kleines Viereck mit einem Brunnen, ein paar sehr dürftigen Blumenbeeten und einem rings um den Brunnen laufenden Asphaltweg für Fußgänger, Hundebesitzer, Gouvernanten und die ihnen anvertrauten Kinder. Ich ging langsam über diesen Platz, den Hund an der Leine, und hörte hinter mir eine Stimme. «Ist dieser Hund ein Chow?» Ich drehte mich um. «Ja», sagte ich, «das ist ein Chow». Auf dem Brunnenabsatz saß ein Mann in ziemlich abgetragenen Kleidern, mit blonden Haaren, die vielleicht schon etwas grau waren, und sehr klaren, hellen, wie von der Sonne und von Salzwasser gebleichten Augen.
«In China und in der äußeren Mongolei heißen diese Hunde anders», sagte der Mann. Ich setzte mich neben ihn, ohne irgend etwas zu überlegen, und obwohl ich eigentlich für meine Verabredung verspätet war. «Woher wissen Sie, wie man Chows in der Mongolei nennt », fragte ich. Der Mann antwortete, er verstehe chinesisch und habe viele solche Hunde dort in China gesehen. Er habe 36,000 Meilen zu Fuß zurückgelegt, auf den Straßen Chinas, in den mongolischen Wüsten, auf den endlosen Strecken zwischen indischen Städten, in Afrika und Australien, – am meisten aber in China. «Ich war nie in der Mongolei, ich bin nie weitergekommen als bis an den Rand von Afghanistan- Turkestan», sagte ich. «Ich bin sieben Jahre lang gegangen», sagte mir der Mann, «ich war zu alt, um eine gute Stelle zu bekommen, da dachte ich, es würde ebenso gut sein, die Welt einmal von innen zu sehen». «Und wie gefällt Ihnen New York? » –«Die gewaltigste Stadt der Welt». –«Aber es ist unerträglich», sagte ich und schämte mich sofort, denn was heißt es, «unerträglich». Der Mann antwortete aber freundlich. «Sie werden eines Tages auch die Mongolei sehen», sagte er, –«wer einmal die fernen Horizonte gesucht hat, wird immer danach suchen. Aber reisen Sie ohne Geld. Gehen Sie zu Fuß. Betteln Sie lieber, als in Luxuskabinen und Plazas zu wohnen. Nicht daß ich gute Betten und gutes Essen verachte, aber es kostet zu viel, das gute Leben. Was ich nun in sieben Jahren gesehen habe – um welchen Preis könnte ich es hergeben?».
Ich hörte ihm kaum zu. Der Abend war hereingebrochen, ich wusste kaum mehr wo ich mich befand. Dann dachte ich plötzlich daran, dass ich mitten in New York sei, vor dem Plaza Hotel – und ob wohl meine Bekannte, eine reiche Amerikanerin, mit der ich zu Mittag gegessen hatte, sich auch auf eine Brunnenstufe setzen würde neben einen sogenannten Landstreicher. Natürlich nicht, – ich lachte hell heraus. Dann sah ich auf die Uhr und dachte, daß die Abendzeitungen schon vor 20 Minuten eingetroffen sein mussten. Mit den Nachrichten aus aller Welt.
[1940]
Orientreisen
Reportagen aus der Fremde. Edition Ebersbach, Berlin 2010
Herausgegeben von Walter Fähnders, 192 Seiten, Abb., gebunden, CHF 34.80. ISBN 978-3-86915-019-2
Annemarie Schwarzenbachs Reisereportagen aus den Jahren 1933 bis 1940 faszinieren durch ihre authentische und bildliche Sprache.Vier Mal fährt Annemarie Schwarzenbach, nach eigenen Worten eine „unheilbar Reisende“, in den Orient. Die erste Reise führt sie 1933/34 in den Nahen Osten, wo sie u.a. an archäologischen Ausgrabungen teilnimmt. Mehrmals bereist sie den Iran, das damalige Persien. 1939 folgt die legendäre, zusammen mit Ella Maillart unternommene Autotour nach Afghanistan. Es ist ein andauerndes „Go East“, das sie durch Anatolien und den Vorderen Orient bis zu den Ruinen von Persepolis führt, in orientalische Metropolen wie Bagdad oder Teheran, schliesslich bis in die Wüsten Turkestans und die Höhen des Hindukusch.
Eine Mischung von historischen und aktuellen „facts“ vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges mit erzählerischen, poetischen Partien und der Wiedergabe eigener, durchaus auch krisenhafter Befindlichkeiten machen den Reiz und auch die Besonderheit dieser Reiseprosa aus.
Die hier versammelten Reisereportagen wurden in den Dreissigerjahren ausnahmslos in der Schweiz veröffentlicht und werden hier zum Teil erstmals wieder nachgedruckt.
www.edition-ebersbach.de
Annemarie Schwarzenbach – eine Schweizer Schriftstellerin und Journalistin.
Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) entstammt einer der angesehensten und reichsten Familien der Schweiz – und gerät früh mit ihr in Konflikt. Die promovierte Historikerin bewegt sich in den antifaschistischen Kreisen um Erika und Klaus Mann und macht sich als Autorin, Fotografin und Reporterin einen Namen. Sie bereist Europa, den Orient, die USA und zuletzt Afrika. Zwischendurch kehrt sie immer wieder in ihre Schweizer Heimat zurück, auch um sich in verschiedenen Kliniken von ihrer Drogenabhängigkeit zu kurieren. Sie stirbt mit nur 34 Jahren nach einem Fahrradunfall und einer darauf folgenden Fehlbehandlung in ihrem Haus in Sils-Baselgia im Engadin.
Walter Fähnders ist apl. Professor für Neuere Germanistik an der Universität Osnabrück. Lehrtätigkeit an den Universitäten Berlin (FU), Bielefeld, Karlsruhe, Klagenfurt und Osnabrück. Walter Fähnders ist seit langem Schwarzenbachforscher und -kenner und Mitherausgeber des Sammelbandes: Annemarie Schwarzenbach. Analysen und Erstdrucke (2005).