
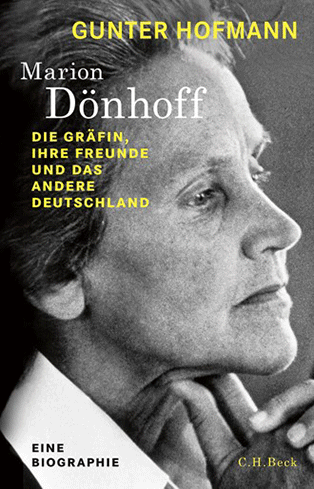

«Usama Al Shahmani: In der Fremde sprechen die Bäume arabisch»
Von Ingrid Isermann
Usama Al Shahmani steckt mitten im Asylverfahren in der Schweiz, ohne Geld, ohne Arbeit, als in Bagdad sein Bruder Ali spurlos verschwindet. In den sicheren Süden wollte er nicht gehen, wenn er Bagdad verlassen soll, dann möge ihn Usama bitte herausholen aus dem Irak. Aber wie soll er zweitausend Dollar für die Flucht nach Beirut aufbringen? Da kommt auch schon die Nachricht von dessen Verschwinden.
Während Usama mit Ankommen mehr als beschäftigt ist, treffen laufend Nachrichten aus dem Irak ein. Bilder aus dem Leichenschauhaus, von denen doch keines Ali zeigt. Windige Typen aus der Hochsicherheitszone in Bagdad, die bestochen werden wollen für angebliches Wissen. Vorwürfe der Mutter, es wäre nicht passiert, wenn er nicht geflüchtet wäre.
Diese persönliche Geschichte und ein im Exil entdecktes, neues Verhältnis zur Natur formt Usama Al Shahmani zu einem vielschichtigen Roman über den Spagat eines Lebens zwischen alter und neuer Heimat.
Ein selten poetisches Buch mit einer authentischen, existenziellen Geschichte, ein anrührender Text des Aufbruchs eines Menschen, der seine Heimat verloren hatte und in der Schweiz eine neue Heimat fand. Dieses Buch gehört zur Schulbuchlektüre!
Auszug aus «Der Baum der Liebe»:
Mir waren alle diese Bäume in dem Wald fremd bis auf einige wenige, die in einer schönen Reihe dastanden wie ein arabisches Gedicht aus sieben Worten. Sie waren mir gleich vertraut, als seien wir alte Bekannte. Sie formten eine Gemeinschaft, wie eine wahre Liebe.
Ich weiß nicht, was mich dazu bewog, diese Bäume mit lauter Stimme anzusprechen. War es ihre beeindruckende Erscheinung? Eine große Linde in der Mitte war für mich wie eine Mutter, und ich sagte in der Stille unter den Bäumen zu ihr auf Arabisch: hub. Das Echo kam nicht als «Liebe» zurück, sondern auf Arabisch. Ich war verblüfft und fuhr fort: semah – schager, Himmel – Bäume.
Hub – semah – schager – Das arabische Echo kam anders aus dem Wald zurück; es hörte sich schlanker an, schärfer.
Es war ein schönes Gefühl, Arabisch zu hören im Wald. Es war also gar nicht so, dass die Natur stumm war, man musste sie nur ansprechen und ihr zuhören. Und die Bäume in der Fremde sprachen sogar arabisch, sagte ich mir und öffnete meine Arme. Ich saugte den Duft der Bäume in mich auf, betrachtete die Zweige und Knospen und spürte, dass mich der Wald annahm. Ich bekam das Gefühl, dass ich die Wege kannte, pfiff auf die Wegweiser – und verirrte mich. Angst, nicht mehr herauszufinden, hatte ich trotzdem nicht.
Im Irak war ich nie im Wald. Die Bilder von Bäumen und Wäldern in meinem Kopf stammen aus Geschichten, die mir meine Großmutter erzählte. Ich wuchs in Städten auf, in denen nur wenig Grünflächen anzutreffen sind. Abgesehen von privaten Gärten sieht man Bäume nur auf den Feldern außerhalb der Stadt.
Unsere einheimischen Bäume, die Dattel-, Oliven-, Granatapfel- und Zitronenbäume, werden von Menschenhand gepflanzt und gepflegt. Bäume in freier Natur wachsen anders, das hatte meine Professorin, die uns damals in moderner arabischer Lyrik unterrichtete, immer wieder betont. Ihre Liebe zur Natur und zu Bäumen war so leidenschaftlich wie die für kurze Texte. Sie war körperlich und geistig fit, und wenn sie von Poeten und Dichtern sprach, war sie sich ihrer Sache so sicher, als hätte sie täglich Umgang mit ihnen.
«Die schönsten Verse der Poesie sind jene, die die Natur widerspiegeln, und ein gutes Gedicht muss man auswendig gelernt haben, um seine Seele lebendig zu halten», sagte sie.
Ihr Einfluss auf die Klasse war groß, viele Studenten waren in sie verliebt, mich eingeschlossen. Sie war schön, offen, liberal, ledig und hatte eine starke Persönlichkeit. Vor so einer Persönlichkeit hatten viele irakische Männer nicht nur Respekt, sondern waren ihr gegenüber sogar achtsam. Bei den Professoren war sie unbeliebt mit ihrem Selbstbewusstsein, starke Frauen sieht man in unserer Gesellschaft, egal in welcher Schicht, nicht gern, man hat lieber schwache, die ohne Mann nicht zurechtkommen. Der Krieg hat die Position der Frau zusätzlich geschwächt und ihr weitere Freiheiten genommen.
Diese Professorin war das genaue Gegenteil solcher Vorstellungen. Einmal sagte sie uns: «Wenn ich mich als Kind zu Hause unterdrückt fühlte, ging ich barfuß in unseren Garten. Ich brach kleine Äste des Granatapfelbaumes ab und begann, mit ihnen zu spielen. Heute noch tue ich dasselbe, denn das beste Mittel gegen die Bitterkeit ist für mich die Nähe zu Bäumen, aber anstatt mit Ästen zu spielen, schreibe ich heute damit ein kurzes Gedicht auf die Erde.»
«Wieso Granatäpfel, haben Sie keine anderen Bäume?», fragte sie eine Studentin.
«Doch, wir haben andere Bäume, aber der Granatapfelbaum ist in unserer Kultur der Baum der Liebe, das müssten Sie eigentlich wissen», sagte sie und begann, ihre Bücher zusammenzuräumen.
Ich wusste, was sie meinte, meine Großmutter hatte es mir einmal erzählt. An jedem Granatapfelbaum hängen viele Granatäpfel, doch nur einer, ein einziger von ihnen trägt einen ganz besonderen Kern. Dieser Kern gehört dem Paradies, und wer diesen Kern gekostet hat, dem soll Liebe, Freude und Glück im Leben widerfahren.
«Teile nie eine Granatapfelfrucht mit jemandem, mein Sohn, denn du weißt nicht, ob du nicht deine Liebe weitergibst», hatte mir meine Großmutter eingeschärft.
«Und du? Du isst ja gerne Granatäpfel. Hast du den Kern in deinem Leben gefunden?», fragte ich sie.
Sie lachte: «Als ich blutjung war, habe ich mit allen Mädchen aus meinem Dorf über die Liebe gesprochen. Wir lachten und kicherten, flüsterten einander aber nur die Hälfte unserer Geheimnisse zu.»
«Ja, aber sag mir jetzt, ob du diesen Kern gefunden hast? Erzähl mir, wie hast du meinen Großvater kennengelernt?»
Meine Großmutter erzählte mir, dass sie ihren Mann bei ihrer eigenen Hochzeit zum ersten Mal getroffen hatte. Es war für die Mädchen damals nicht möglich, ihren Bräutigam vor der Hochzeit kennenzulernen. «Ich konnte ihn durch das Fenster sehen, als sein Vater mit ihm in unser Haus kam. Sie haben um meine Hand angehalten», erzählte sie, es war ein sonniger Wintertag, sie hatte meine kleine Schwester auf dem Schoß, streichelte sanft über ihr Haar und fuhr fort: «Ich habe in der gleichen Nacht geweint. Ich hatte Angst, denn er sah aus wie der Stamm einer Dattelpalme, ich wollte ihn nicht heiraten. Meine Mutter versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ein kräftiger, starker Mann Glück im Leben bringe. Sie sagte mir, ich solle in der Hochzeitsnacht meinen Fuß mit etwas Druck auf den rechten Fuß meines Bräutigams legen. Dadurch würde ich das letzte Wort im Hause haben.»
«Aber das hast du ja wirklich! Hast du fest gedrückt?», fragte ich verwundert.
«Nein, ich kam gar nicht dazu.»
«Und bist du durch diese Heirat glücklich geworden?» Nachdenklich faltete sie ihre Hände und schaute mich einen Moment an.
«Ob ich glücklich bin, das weiß ich nicht, mein Junge. Ich habe einfach geheiratet.»
Sie kannte das Glück nicht, und trotzdem strahlte sie stets Liebe und Licht aus und trug ein sanftes Lächeln. Sie war wie eine Sonnenblume: Sie benötigte keinen Kompass, um sich der Sonne zuzuwenden. Jede Begegnung mit ihr war für mich wie ein neuer Anfang, um das Leben im Irak zu ertragen. Sie hat für die Familie viel Gutes getan, trotzdem ist von ihr nicht viel geblieben. Das Haus, in dem sie mit meinem Großvater und ihren acht Kindern ein halbes Jahrhundert lebte, wurde verkauft und vom neuen Besitzer abgerissen, um Platz zu schaffen für eine Autowaschanlage. Auf meiner letzten Reise in den Irak musste ich feststellen, dass keines der über vierzig Enkelkinder etwas von ihr erzählen oder eine persönliche Erinnerung mit mir teilen konnte. Wie kann es sein, dass von einem Menschen, den alle geliebt haben, nichts bleibt, nicht einmal ein Foto?
Dass kein Granatapfelbaum in diesem Wald zu finden war, hatte mich nicht daran gehindert, dasselbe zu tun. Ich versuchte, wie meine Professorin meine Worte mit Ästen auf den Boden zu schreiben. Ich wischte das Laub zur Seite und schrieb ein kleines Gedicht:
Ich bin der Fremde. Ich habe Hoffnung
und einen Koffer voller Geheimnisse. Beides trage ich und gehe,
wie ein Sufi, der geduldig
zu blühen versucht, wo immer der Herr ihn hingepflanzt hat.
Als ich die Zeilen auf dem Waldboden hinterließ, beruhigte mich der Gedanke, dass sich ein Leser wohl auch etwas fremd vorkommen würde, wenn er meine arabischen Zeichen antraf. Kann man sich in der Natur fremd fühlen?, fragte ich mich. In jenem Moment empfand ich absolute Liebe und Zugehörigkeit.
Usama Al Shahmani, *1971 in Bagdad und aufgewachsen in Qalat Sukat, hat arabische Sprache und moderne arabissche Literatur studiert, er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 wegen eines regimekritischen Theaterstücks fliehen musste. Er arbeitet heute als Dometscher und Kulturvermittler und übersetzt ins Arabische, u.a. Werke von Thomas Hürlimann. Shahmani lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. Förderpreis der Stadt Frauenfeld.
Usama Al Shahmani
In der Fremde sprechen die Bäume arabisch
Roman
Limmatverlag Zürich, 2018
192 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
CHF 29. € 25. eBook CHF 24.80.
978-3-85791-859-9
«Gunter Hofmann: Marion Dönhoff – die Gräfin, ihre Freunde und das andere Deutschland»
Im Januar 1945 schwingt sich eine junge Frau aufs Pferd und reitet auf der Flucht vor der Roten Armee von Ostpreussen in den Westen. Ohne Hitlers Krieg hätte Marion Dönhoff ihr Leben vermutlich als Gutsherrin auf Schloss Friedrichstein verbracht, so wurde sie «die Gräfin» und eine Schlüsselfigur der Bundesrepublik.
Gunter Hofmann geht den Spuren der grossen deutschen Journalistin Dönhoff nach, die der ZEIT ihre Haltung gab, die mächtigsten Männer der Welt zu ihren persönlichen Freunden zählte und dabei stets von einer Aura der Unnahbarkeit umgeben blieb.
Die Lebensgeschichte von Marion Dönhoff ist die Geschichte einer Ausnahmefrau. Doch wer sie erzählt, erzählt zugleich davon, wie die Bundesrepublik wurde, was sie ist. Nur wenige Menschen haben die Werte, auf denen nach der Diktatur des Naziregimes die Demokratie gegründet wurde, so entschieden und so leidenschaftlich vertreten, mitgestaltet und vorgelebt wie Marion Dönhoff. Das Erbe Preussens und das Erbe des Widerstandes fliessen in dieses Ringen um ein anderes, besseres Deutschland ebenso ein wie der Drang nach Freiheit und die Überzeugung, dass die Zukunft Deutschlands im transatlantischen Westen liegt. Zugleich war die «Gräfin» ein Genie der Freundschaft und von einer unerschütterlichenTreue.
Mitspracherecht für die DDR
Nachgeborenen muss man den Namen Marion Dönhoff oft neu erschliessen; ihre Geschichte und die ihrer Bekanntschaften und Netzwerke erzählt Hofmann ebenso wie von ihrem Deutschland-Bild, mit viel Empathiel, doch nicht unkritisch und mit Blick auf die grössere Perspektive, sodass nebenher auch die rasante Geschichte der Bundesrepublik zur Sprache kommt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Dönhoff nach dem Kollaps der DDR dazu anregte, eine gemeinsame Verlautbarung zu schaffen, wie man die beiden deutschen, unterschiedlichen Staaten zusammenfügen könnte, der DDR ein Mitspracherecht einzuräumen. Kohl war dagegen, stattdessen wurden über die Treuhand alle Betriebe „abgewickelt“ und die Arbeitsplätze vernichtet. Dass sich diese Handlungsweise u.a. sehr viel später nun in einem rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Aufbegehren wie seitens der AfD manifestiert, ist auch ein Erbe dieser kurzsichtigen Politik. Der Osten Deutschland fühlt sich bevormundet und nicht integriert, das hatte Dönhoff, selbst aus dem Osten Deutschlands stammend, vorausgesehen. Eine hochaktuelle Geschichtslektüre, die in die Gegenwart reicht.
Gunter Hofmann war bis 2008 Chefkorrespondent der ZEIT. 2003 erhielt er für sein Buch «Abschiede, Anfänge – Die Bundesrepublik. Eine Anatomie» den Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung für das beste politische Buch des Jahres. Sein Buch «Helmut Schmidt. Soldat, Kanzler, Ikone» (2015) war wochenlang auf den Bestsellerlisten.
Leseprobe:
Die Frau, Jahrgang 1909, die wir «Gräfin» nannten, kam nicht als Liberale und nicht als Journalistin zur Welt. Nichts war prädestiniert. Sie musste sich erobern, was sie wurde. Sie kam aus einer unvorstellbar anderen Welt. Je näher ich hinsah auf ihren Lernprozess, umso klarer wurde mir: Ein Buch über das Leben in so vielen Zeitzonen, das politische Erwachen, den intellektuellen Werdegang von Marion Dönhoff würde auch eines darüber sein, wie die Bundesrepublik wurde, was sie ist. Beides schien auf eigentümliche Weise eng miteinander verflochten.
Nichts verlief nach Plan. Ohne Hitler hätte sie wohl das Leben einer Gutsverwalterin auf Schloss Friedrichstein oder Quittainen (das rund 120 Kilometer westlich vom ehemaligen Königsberg liegt) im äußersten Winkel des Reiches weitergelebt. Hitlers Überfall auf Polen, der Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion, der Verlust der Heimat änderten alles. Sie musste sich nach 1945 selbst neu erschaffen. Aber im kargen Gepäck beim Ritt in den Westen brachte sie dazu mehr mit, als es auf den ersten Blick scheinen mochte. Von dem, was sie mitbrachte und was sie daraus machte, möchte ich berichten. Aber auch davon, dass die Bundesrepublik, Jahrgang 1949, gleichfalls nicht fertig war und nicht liberal. Ein großes Selbstver- ständigungsgespräch ging dem voraus, an dem sie sich auf ihre Weise beteiligte. Früh hörte man dabei ihre Stimme heraus. Solche Stimmen machten die Republik zu dem, was sie wurde.
Kennengelernt habe ich sie, als sie längst schon die Reputation der großen Dame des Journalismus genoss, als publizistisch-moralische Instanz der Bundesrepublik. Sechzig Jahre alt war sie damals. Es gab ein öffentliches Bild von ihr, das sie zweifellos mitgeprägt hatte. Auffallend schien mir, dass sie keinen Unterschied zwischen öffentlich und privat machte. Sie gab nur den Blick auf diese eine Marion Dönhoff frei. Selbstbewusst und uneitel zugleich wirkte sie. Brennend interessiert war sie an allem Politischen. Auch Männer, die Macht hatten, konnten sie anziehen: Henry Kissinger, Michail Gorbatschow, Helmut Schmidt … Von solchen Gesprächen konnte sie lange erzählen und schwärmen. Zwischen Washington, Moskau, Warschau oder Johannisburg bewegte sie sich wie zu Hause, die intelligenten Köpfe hinter den Kulissen – Walt Rostow, Valentin Falin, Egon Bahr, George Kennan, Zbigniew Brzeziński – schienen sie jedoch oft mehr zu interessieren als diejenigen an der Spitze und im Rampenlicht. Zur Welt der Politik, in der es vorwiegend um Image, Inszenierung, Taktik und Wirkung ging, hielt sie Distanz. Ohne sie konnte ich mir die ZEIT bald schon schwerlich vorstellen. Ich wusste nicht, warum.
Sie kam die paar Schritte aus ihrem Arbeitszimmer im sechsten Stock herüber, nahm im kleinen Konferenzraum Platz auf dem Stuhl, der immer für sie freigehalten wurde, man spürte, sie war hier zu Hause. Sie verkündigte nichts ex cathedra, sie redete einfach mit, sparsam, leise, unüberhörbar. Sie war von hoher Präsenz. Gute dreißig Jahre habe ich sie so erlebt. Es war nicht zu übersehen: Niemand sonst stand ihr on the job ähnlich nahe wie Theo Sommer, ihr Nachfolger als Chefredakteur, der sie «Marion» nannte und ihr an Weltläufigkeit nicht nachstand, sowie Haug von Kuenheim, sein Stellvertreter, der auf privilegierte Weise ihr Vertrauen genoss. Beim sonntäglichen Spaziergang an der Elbe, zu dem sie ihn regelmäßig einlud, tauschten sie sich gern aus – über die politischen Weltläufte und vor allem über die ZEIT, allzu Privates blieb ausgespart. Sie brauchte das dennoch. Vielleicht, weil er als einziger im Kollegium eine Brücke bildete zur Welt, aus der sie kam. Helmut Schmidt, den sie schätzte, als Politiker wie als Herausgeber an ihrer Seite, war ein Fall für sich; es blieb auf beiden Seiten respektvolle Distanz.
Vor Augen habe ich sie, als sie nach ihrem 90. Geburtstag einer Einladung Gerhard Schröders ins neue Kanzleramt in Berlin folgte. Sie ließ sich – neugierig wie gewohnt – vieles zeigen, den Kabinettssaal, die Kanzlerportraits in der Lobby, sein Arbeitszimmer mit den erlesenen Bildern befreundeter Künstler, die breite Veranda mit Blick zum Tiergarten, schließlich die Privaträume, die ihr doch arg klein vorkamen für einen deutschen Regierungschef. Zum Mittagessen hinterher saß sie ihm dann, unauffällig elegant und strahlender Laune, am Tisch im Restaurant des Hotels Adlon gegenüber. Ich entsinne mich, wie sie ihm einfache, vielleicht sollte man besser sagen: naive politische Fragen stellte. Direkt, immer gleich zum Punkt. Hat er eine Idee, wie das Verhältnis zu Russland verbessert werden kann? Lässt sich im Nahen Osten vielleicht doch einmal ein dauerhafter Frieden erreichen? Welche Folgen wird die militärische Intervention des Westens am Kosovo haben? Und Präsident Clinton, wie schätzt er ihn ein? Was man so wissen möchte von einem verantwortlichen Politiker, aber meist doch nicht fragt.
Tapfer, galant und ungewohnt geduldig versuchte der Gastgeber beim Essen, der Blick ging auf den Pariser Platz und auf das Brandenburger Tor, der alten Dame nach bestem Gewissen Rede und Antwort zu stehen. In ihren Augen bestand er. Überrascht übrigens war sie nicht von dieser Einladung, wie mir schien. Seit Jahrzehnten war sie es gewohnt, dass ihr die Türen in aller Welt offenstanden, sie musste erst gar nicht anklopfen. Soweit handelte es sich um einen normalen Tag im Leben der Journalistin Marion Dönhoff. Natürlich freute sie sich und wusste die Ehre zu schätzen, zudem wünschte sie gerade Schröder und seiner rot-grünen Koalition mit Joschka Fischer ohnehin viel Glück. Die Kohl-Ära war vorbei, endlich. Sie atmete auf, unter einer guten Regierung hatte sie sich etwas anderes vorgestellt, so glücklich sie auch über seinen entschiedenen Kurs nach dem Mauerfall in Richtung Einheit und seine europäische Grundhaltung war.
Kohl selber hatte als Kanzler früh öffentlich abschätzige Bemerkungen über sie gemacht, er zählte sie zur Weizsäcker-Republik, von der er sich nicht akzeptiert fühlte. Sie hingegen erhoffte sich jetzt, 1998, von den Nachfolgern etwas Neues, obwohl sie sich mit den grünen Blumenkindern nur sehr langsam hatte anfreunden können, Angst vor Experimenten aber hatte sie nicht, wie sich einmal mehr zeigen sollte – sie liebte solche Anfänge, noch mit neunzig. Konservativ war sie als junge Frau, nicht jetzt. Welche Einheit es werden solle, darüber allerdings hätte sie wohl gestritten – sie sympathisierte mit Richard von Weizsäckers Wort vom «Innehalten», das darauf abzielte, über etwas gemeinsam Neues nachzudenken und den Osten nicht mit Westhochmut und Westdominanz einfach zu überrumpeln. Vielleicht könnte man so einem anderen, dritten Deutschland nahe kommen? Sie wünschte es sich sehr. Noch 1995, in der «Mittwochgesellschaft», die sie ins Leben rief, verfolgte sie mit ihrem Freund Richard diese Spur. Alles vergebens, nicht nur Kohl stand dem entgegen, die deutschen Ver- hältnisse insgesamt ließen einen derart grundsätzlichen Anfang nicht zu.
Vor Augen habe ich sie, wie sie hereinschneite ins Hauptstadtbüro und sich erkundigte, ob ein Zimmer frei wäre für sie, sie müsse noch rasch einen Artikel schreiben. Sie verschwand, schrieb konzentriert mit der Hand in zierlichen Lettern, diktierte den Text dann ohne Hektik in die Olivetti, und erschien nach spätestens einer Stunde strahlend mit einer fertigen Fassung, die wir gern lesen könnten. Ich wunderte mich, weil sie nichts daran korrigierte, kein Komma.
Sie besaß die Gabe, über die auch talentierte Politiker verfügen, komplexe Sachverhalte traumwandlerisch sicher auf ihren Kern zu reduzieren. Sie war eine Stimmensammlerin, nicht nur in den Konferenzen, Stimmen ernst zu nehmen war eine Lebenshaltung. Stimmen ließ sie zu Worte kommen in ihren Reportagen, Stimmen amerikanischer Farmer, arabischer Scheichs, indischer Abenteurer, Stimmen von Zukurzgekommenen, von Intellektuellen, von unbe- kannten Politikern, von führenden Staatsmännern. Möglichst im Wortlaut gab sie gern wieder, was sie gehört hatte, wenn sie ihr Vis- à-vis ernst nahm. Das blieb ihr journalistischer Ansatz bis zuletzt. Sie wollte lernen, fair rapportieren, aber dann auch klar Stellung nehmen, wenn nötig.
Als private Marion Dönhoff, die es zweifellos gab, bekam unsereins sie gar nicht zu sehen. Die Frau also, die auf die Frage, was sie in ihrer Freizeit mache, einmal antwortete, «ich wurschtele so vor mich hin»; die sich stets unter Kontrolle hatte, aber ihrem Hund Basra schier alles erlaubte; oder die, wie gern kolportiert wurde, morgens in ihrem Porsche in einem Tempo ins Büro fuhr, als gelten keinerlei Regeln für sie. Vor Augen habe ich, wie sie immer gleich zur Sache kam im Gespräch, direkt, freundlich, uneitel, von Kopf bis Fuß auf Politik eingestellt. Neugierig fragte sie bis ins hohe Alter, wenn sie nach Bonn kam, wen sie denn kennenlernen müsse, wen zu sprechen sich lohne, wer interessant sei unter den Grünen, oder welche jungen Abgeordneten, die wirklich etwas zu sagen haben … Auf autonome Urteile war sie begierig, nicht auf die konventionellen Meinungen, kennenlernen wollte sie gerade auch die bunten Vögel, die Exzentriker, die sich den Schablonen entziehen.
Ungeduldig, ungnädig und streng bleibt sie aber auch in Erinnerung, wenn sie Maßstäbe bedroht sah, oder Freundschaften in Frage gestellt wurden, an denen ihr Herz hing. Vorbehaltlos konnte sie dann plötzlich Partei ergreifen. In der Regel jedoch verstand sie sich als Moderatorin. Jeder sollte sich sein eigenes Urteil bilden können. Am Ende allerdings musste sich die Zeitung in großen Kontroversen natürlich auch selbst positionieren. Bloß keine billigen Kompromissformeln, keine Anbiederei! Marketingjournalismus blieb ihr ein Horror, eigentlich erkannte sie das gar nicht als Journalismus an. Ihre Zeitung sollte natürlich erfolgreich sein, aber den Erfolg durfte sie sich nicht kaufen, indem sie auf Auflage schielte, auf Popularität als Selbstzweck. Eisern war sie davon überzeugt, Eigensinnigkeit sei die wahre Erfolgsgarantie für ein anspruchsvolles Blatt.
Gunter Hofmann
Marion Dönhoff
Die Gräfin, ihre Freunde und das andere Deutschland
C.H. Beck Verlag, München 2019
Gebunden, 480 Seiten, 28,00 EUR
ISBN 9783406725920
«Zeichnungen von Leonardo da Vinci – 200 Meisterwerke aus der Royal Collection»
Anlässlich des 500. Todestages des Universalgenies Leonardo da Vinci finden 2019 in Grossbritannien eine Reihe von Ausstellungen statt, die zu Jahresmitte in der Ausstellung der Queen’s Gallery im Buckingham Palace, London, gipfeln. Der offizielle Begleitband «Leonardo da Vinci. Das Genie als Zeichner» enthält alle Exponate dieses aussergewöhnlichen Ausstellungs-Events.
Autor und da Vinci-Experte Martin Clayton erschliesst im Katalog einen besonderen Zugang zu den Hauptwerken da Vincis aus der Royal Collection.
Die Zeichnungen Leonardo da Vincis zählen zu den technisch vollkommensten und faszinierendsten Zeichnungen der Kunstgeschichte und markieren den Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens.
2019 präsentiert die Royal Collection, verteilt auf 12 Museen, 144 Werke, gekrönt von einer Zusammenführung und Ergänzung aller Exponate in der Queen’s Gallery im Buckingham Palast im Mai 2019.
Martin Clayton ist Leiter der Graphischen Sammlung des Royal Collection Trust. Er gilt als Spezialist für Leonardos Zeichnungen und hat bereits zahlreiche Publikationen zu Werken der Royal Collection veröffentlicht.
Martin Clayton
Leonardo da Vinci
Das Genie als Zeichner
Belser Verlag, 2018
Format 19,8 x 21 x 25,4 cm
200 Farbfotos
256 Seiten
Klappenbroschur
€ 38,00 [D]. € 39,10 [A] € 46,90 [CHF]
ISBN 978-3-7630-2819-1

